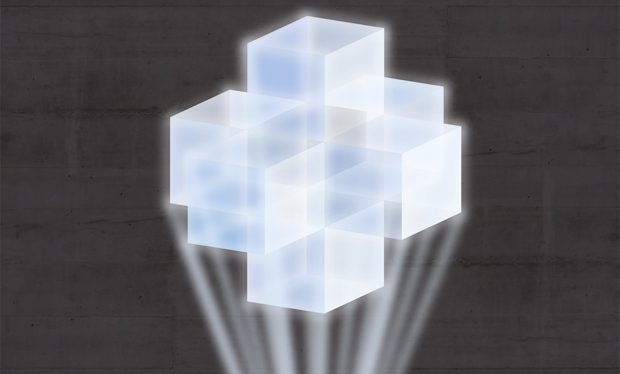Wetterprognose
Der alte Kontinent zeigt sich so verunsichert und instabil wie selten zuvor. Die Analyse der aktuellen politischen Grosswetterlage Europas gibt wenig Anlass zur Hoffnung.
Haben Sie auf Ihrem Handy auch die App von Meteo Schweiz? Konsultieren Sie sie auch so oft wie ich? Am liebsten mag ich die animierte Niederschlagskarte: Unheimlich, wie sich eine schwere Gewitterzone auf Solothurn zubewegt! Noch zwei Stunden, noch eine Stunde, drohende Wolken über dem Weissenstein, und dann: kein Tröpfli. Na ja, so genau kann man das eben offenbar nicht vorhersagen, denn beim Wetter handelt es sich um verwirbelte, turbulente Strömungen, hochkomplexe Phänomene. Ich will deshalb keineswegs die Meteorologen anklagen, und im grossen und ganzen sind die Prognosen ja auch besser geworden – vor allem dann, wenn es stabile Grosswetterlagen gibt, ausgedehnte, unbewegliche Hochdruckgebiete, wochenlange Bisenlagen. Wenn jedoch Gewitterfronten über Europa hinwegbrausen, dann soll man sich auf alles gefasst machen!
Auch Gesellschaften sind hochkomplex, verwirbelt und turbulent, zumal hier, im Gegensatz zum Wetter, Vorstellungen, Ideen und Ideologien der Menschen auf das reale Geschehen zurückwirken. Dazu kommt, dass der Homo sapiens für seinen Verstand einen hohen Preis bezahlt: Neigung zu Wahnvorstellungen, Irrsinn und Demenz. Wer wagte da vorherzusagen, was morgen sein wird! Doch auch hier gilt: Es gibt relative stabile Grosswetterlagen, in denen über die nähere Zukunft Aussagen mit guter Trefferwahrscheinlichkeit möglich sind, etwa Europa vom Wiener Kongress bis zu den deutschen Einigungskriegen oder die Pax americana zur Zeit des Kalten Krieges.
Davon kann heute keine Rede mehr sein. Wir verzichten darauf, die lange und immer länger werdende Liste der Kriege und Krisen, die uns gegenwärtig heimsuchen, nochmals herunterzubeten. Inzwischen vergeht kaum eine Woche ohne neue Hiobsbotschaften: Terroranschläge, Amokläufe, Flugzeugabstürze, sinkende Flüchtlingsboote, wiederaufflammende Bankenkrisen. Und man hat nicht den Eindruck, dass die politischen Interventionen solchem Ungemach gewachsen sind: Das Fluten der Finanzmärkte mit billigem Geld bringt die Wirtschaft nicht auf Trab; die Sperrung der Balkanroute vermehrt die Flüchtlinge im Mittelmeer; die Ausrufung des Ausnahmezustandes stoppt den Terror nicht; Sanktionen zwingen Putin nicht zum Rückzug, Konzessionen an Grossbritannien verhindern den Brexit nicht. Wenn man in der neueren europäischen Geschichte eine vergleichbare Phase von Verunsicherung und Destabilisierung sucht, stösst man auf die Zeit der Weimarer Republik. Damals haben Tucholsky und andere die Prognose gestellt: Es wird böse enden! Und das tat es dann auch.
An Vorhersagen und Ratschlägen fehlt es nicht
Im Tagesrhythmus melden sich heute Experten und Auguren zu Wort. Ihre Ansichten reichen von schwärzestem Pessimismus über milde Hoffnung bis zum Vertrauen auf die heilende Kraft von Krisen. Doch wer hat recht, wem soll man vertrauen? Kommt einer heute mit einem Rezept, widerspricht ihm sein Kollege morgen schon. Selbst die Ökonomen mit ihren ausgefeilten mathematischen Modellen wirken seit der Finanzkrise noch hilfloser als vorher. Kurz, keiner weiss, wie es weitergeht. Doch da diese Botschaft keine Schlagzeilen macht, müssen die Medienleute so tun, als ob sie es wüssten – im Vertrauen darauf, dass, was heute geschrieben und gesagt wird, morgen schon vergessen ist. Und da auch die Politiker nicht gerne zugeben, mit dem Rücken zur Wand zu stehen, wursteln sie sich eben irgendwie durch.
«Kurz, keiner weiss, wie es weitergeht.»
Mit diesem Bekenntnis zum Nichtwissen habe ich mir nun selbst den Ast abgesägt, auf dem meine Weisheit zu Europa hätte spriessen sollen. Auf Prognosen und Ratschläge jedenfalls werde ich verzichten müssen, Bescheidenheit ist angesagt. Ein Blick zurück auf die Entwicklung der europäischen Integration gibt vielleicht Hinweise auf mehr oder weniger wahrscheinliche Tendenzen. Wenn der Politikwissenschafter im wogenden Auf und Ab der Tagespolitik nach stabilen Elementen sucht, dann wird er am ehesten bei den verfassungsmässig festgelegten Institutionen fündig. Die politischen Institutionen der meisten europäischen Staaten sind zurzeit noch einigermassen intakt und in der Lage, die ihnen zugedachten Funktionen zu erfüllen. Einigermassen. Doch wie ist das mit den Angriffen der polnischen Regierung auf das Verfassungsgericht oder mit Ungarns Beschränkung der Meinungsfreiheit? Wie lange bleiben Flandern und Wallonien noch zusammen, wie stark werden die Sezessionsbestrebungen Kataloniens Spanien erschüttern? Kann Frankreich den ökonomischen Niedergang noch aufhalten? Wann bricht Griechenland zusammen? Die Toleranz und Offenheit der skandinavischen Staaten haben gelitten. Die italienische Mafia metastasiert in ganz Europa. Populistische, fremdenfeindliche und EU-verachtende Parteien gewinnen überall an Einfluss. Trotzdem, die Gewaltenteilung bleibt gewahrt, die Medien erfüllen ihre Aufgabe, Wahlen laufen geordnet ab, nirgends gibt es bürgerkriegsähnliche Zustände, das staatliche Gewaltmonopol ist nicht in Frage gestellt.
Und wie steht es mit der Europäischen Union? Auch hier schauen wir zuerst auf die Institutionen, welche allerdings ungewohnt, ungefestigt und schwer zu verstehen sind – was allein schon ihre legitimatorische Funktion beschränkt. Ein Blick zurück. Zwischen 1983 und 1992 erlebte die EG mit dem Binnenmarktprogramm einen fulminanten Aufschwung; sie wurde immer attraktiver, Österreich, Schweden und Finnland traten bei, und selbst in der Schweiz keimten solche Gelüste. Die Institutionen der damaligen EG waren weitgehend die ursprünglichen der EWG aus den fünfziger Jahren: Kommission, Ministerrat, Gerichtshof und ein Parlament mit beschränkten Befugnissen – ein neuartiges, «supranationales» System. Eine wichtige Vertragsveränderung gab es allerdings 1987 mit der Einheitlichen Europäischen Akte: Künftig war bei der Beschlussfassung für Rechtsvereinheitlichungen im Binnenmarktbereich nicht mehr die Einstimmigkeit erforderlich, sondern nur noch die qualifizierte Mehrheit.
Der grosse Sprung nach vorn
Ist es nicht erstaunlich, dass mit den 1957 konzipierten Institutionen dreissig Jahre später ein solch mächtiger Integrationsschub wie das Binnenmarktprogramm möglich war? Nicht unbedingt, denn auch die Ziele waren dieselben geblieben: Herstellung eines grossen gemeinsamen Marktes mit der freien Zirkulation von Menschen, Gütern, Dienstleistungen und Kapital. Erstaunlich vielmehr ist die Fähigkeit der Väter der Römer Verträge, damals ein institutionelles Ensemble erfunden zu haben, welches es am Schluss schaffte, praktisch alle Schranken gegen den freien ökonomischen Austausch zwischen einer grösseren Anzahl von Staaten zu überwinden – eine Weltpremiere. Dies wäre allerdings nicht möglich gewesen, wäre wirtschaftliche Öffnung nicht ein Positivsummenspiel, welches Europa zu Wachstum und Wohlstand verhalf und damit allfällige Demokratiedefizite des Systems kompensierte. Als Kollateralschaden ist zu verbuchen, dass sich dabei öfter französisch-etatistische Vereinheitlichungstendenzen durchsetzten, die den Wettbewerb beschränkten und das «Bürokratiemonster» hervorbrachten. Natürlich gab es während dieser dreissigjährigen Periode auch immer wieder Pläne und Versuche, die europäische Integration auf andere politische Felder auszuweiten – Währung, Aussenpolitik, Finanzen. Erreicht wurde jedoch höchstens eine freiwillige, intergouvernementale Kooperation der Willigen, etwa mit der Europäischen politischen Zusammenarbeit, dem Europäischen Währungssystem oder mit dem Schengener Abkommen.
Es handelte sich also um ein institutionelles System, welches darauf kalibriert war, einen gemeinsamen Markt oder Binnenmarkt zu ermöglichen und zu legitimieren, keinesfalls aber war es dafür gedacht, schwergewichtige, souveränitätsbeschränkende Staatsfunktionen zu übernehmen. 1989 änderte dies. Die Binnenmarkteuphorie traf auf den Untergang des Sowjetsystems, der neue Osten weckte ebenso grosse Hoffnungen wie Befürchtungen, und die deutsche Wiedervereinigung verschob die Gewichte in der EU – die Gemütslage wurde höchst ambivalent. Anstatt nun abzuwarten und das Erreichte zu konsolidieren, bis sich die Nebel lichteten, setzte sich die Überzeugung durch, dass es nun an der Zeit sei für den grossen Sprung nach vorn. Maastricht, Währungsunion, Wirtschaftsunion, Raum ohne Binnengrenzen, politische Union, gemeinsame Aussen- und Sicherheits-, ja Verteidigungspolitik. «Gemeinschaft» hatte ausgedient, «Union» sollte es nun heissen. Einige Staaten – allen voran Grossbritannien – wollten da nicht mehr überall mittun. Dies hätte eine Warnung sein müssen, stattdessen wurden diese partiellen Exits zu «verschiedenen Geschwindigkeiten» oder «variabler Geometrie» euphemisiert. Dass man eine Währungsunion aufgleiste, nicht aber eine entsprechende (finanz)politische Union, hätte zögern lassen sollen. Und dass man eine grosse Zahl neuer Staaten in die Union und später in die Währungsunion aufnahm, welche der gültigen Aufnahmekriterien spotteten, führte zu den Überdehnungen, welche die EU heute lähmen.
Zurück zu den Institutionen: sie blieben für den Binnenmarktbereich die alten und funktionierten auch weiterhin. Doch darübergestülpt wurden nun vielfältige intergouvernementale und hybride institutionelle Lösungen, die sich durch grössere Willkür sowie geringere demokratische und richterliche Kontrolle auszeichneten. An die Stelle ökonomischer Positivsummen traten Machtnullsummen, wenn nicht Negativsummenspiele. Wo es stärkerer demokratischer Legitimation bedurft hätte, wurde sie schwächer. Wohl hat man versucht, die Institutionen umzubauen, den neuen Aufgaben und der grösseren Mitgliederzahl anzupassen. Doch das Erfordernis der Ratifikation durch alle Staaten blieb, doch diese wurden immer heterogener und deshalb gelang ein entscheidender verfassungspolitischer Schritt nicht. Der «Verfassungsvertrag» scheiterte 2005 ausgerechnet am Nein der beiden Gründerstaaten Frankreich und Niederlande. Kleinere Anpassungen erlaubten eine holprige Weiterfahrt. Dafür wurden die Ankündigungen immer grossartiger: eine Euromediterrane Partnerschaft sollte entstehen, die EU zum «wettbewerbsfähigsten, dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum» werden. Sie platzten wie Seifenblasen. Die Stabilitätskriterien im Euroraum wurden von Anfang an verletzt, Sanktionen blieben aus, die Euro- und Griechenlandrettung wurde zur schmerzhaften Hängepartie. Deutschland, welches nach der Wiedervereinigung mittels des Euro stärker hätte eingebunden werden sollen, wurde des Euro wegen stärker und stärker, seine Vormachtstellung ist nicht mehr zu übersehen. Wenn es um die Sicherheit geht, muss nach wie vor die Nato einspringen, die Flüchtlingsströme werden mittels nationaler Grenzzäune und fragwürdiger Arrangements mit der Türkei gebremst.
Teufelskreis des Niedergangs
Dazu kommen die nationalistischen, fremden und EU-feindlichen Aufwallungen in beinahe allen Mitgliedstaaten. Man mag das kritisieren und irgendwelchen populistischen Anführern in die Schuhe schieben. Dass viele Menschen angesichts der Lage der Dinge zutiefst verunsichert sind, ist nicht erstaunlich. Doch an wen sollen sie sich wenden in der Not? An die EU, welche täglich ihre Unfähigkeit, der Probleme Herr zu werden, demonstriert? Dann doch eher an den eigenen Staat, der einem einigermassen vertraut ist. Auch er löst zwar internationale Probleme und Krisen nicht, aber er verspricht noch am ehesten Schutz vor Ungemach: Er verfügt über die staatlichen Gewaltmittel – nach innen und nach aussen. Er verfügt über 98 Prozent der öffentlichen Geldmittel (also die EU unter zwei Prozent). Er garantiert – hoffentlich! – die Sozialversicherungen. Nur er kann allenfalls eine Wirtschaftspolitik betreiben, welche die Arbeitslosigkeit mindert. Nur seine Politiker können gegebenenfalls durch Abwahl zur Rechenschaft gezogen werden. Und wo er versagt, kann wiederum die EU angeklagt werden, die angeblich seine Souveränität und Handlungsfähigkeit beschränkt. Dieser Rückzug hinter die nationalen Grenzen und auf nationale Traditionen verhindert erst recht gemeinsame, EU-weite Lösungen. Ein Teufelskreis, eine Abwärtsspirale.
Die EU wird nicht von einem Tag auf den andern verschwinden, sie wird nur durch Legitimationsentzug schwächer und unbedeutender. Die Währungsunion wird nicht zu halten sein, vielleicht nicht einmal die Freizügigkeit und Schengen. Zurzeit ist kein Staat und keine Staatengruppe in Sicht, welche diesen Niedergang aufzuhalten vermöchte, keine der angebotenen Rezepturen zur Rettung überzeugt. Aber wie gesagt: politische Prognosen sind auch nicht besser als die für das Wetter.