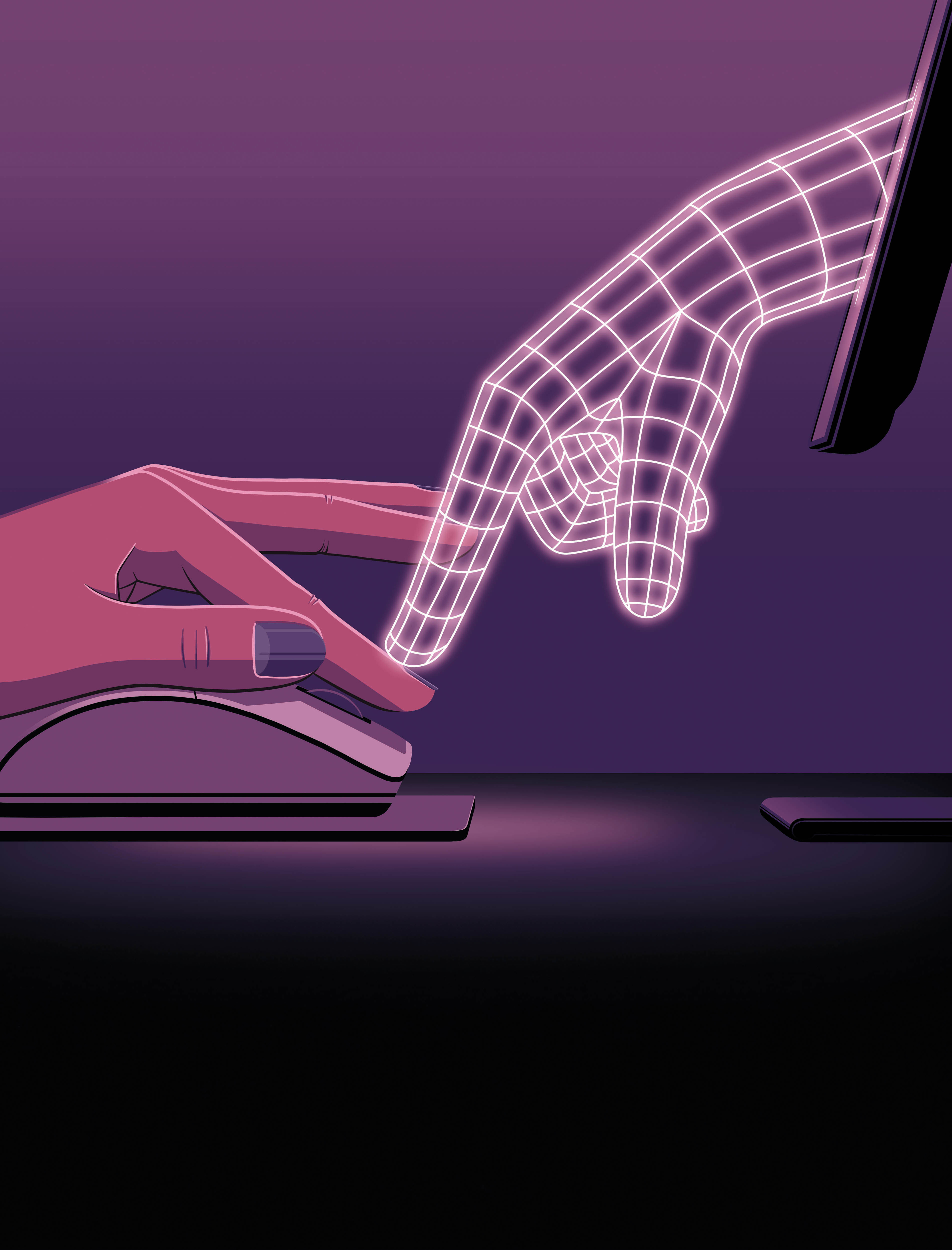Tschüss Komfortzone, hallo Einflusszone!
Ein Ende des Ukrainekriegs ist vor den US-Wahlen nicht zu erwarten. Die EU dürfte von den Ereignissen zu einer grundlegenden Reform gezwungen werden – oder weltpolitisch in die Bedeutungslosigkeit versinken.
Es ist schon erstaunlich, wie schnell sich die meisten europäischen Politiker und eine Mehrheit der Menschen unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine von ihren politischen Zukunftsvorstellungen verabschiedet haben: von dem Projekt, wonach wirtschaftliche Macht an die Stelle militärischer Macht als Steuerungsmedium der internationalen Ordnung treten werde; von der Vorstellung, dass verbindliche Regeln und internationale Schiedsgerichte die Interessengegensätze der Staaten klären und beilegen sollen; von der Überzeugung, dass die internationale Ordnung eine des Friedens ist, in der Kriege keine Rolle mehr spielen. US-amerikanische Autoren hatten die Europäer wegen dieser (Wunsch-)Vorstellungen verspottet: Die Europäer seien von der Venus, während die Amerikaner vom Mars seien, so Robert Kagan. Zeitweilig hatten die Europäer bei dieser Gegenüberstellung die Oberhand, denn das militärische Agieren der USA war nicht von Erfolg gekrönt. Und wo die Europäer, wie in Afghanistan, den amerikanischen Vorgaben folgten, wurden auch sie ins Scheitern hineingezogen.
Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich all das verändert: Mit einem Schlag sassen die Amerikaner (sowie Polen und die baltischen Staaten) auf dem hohen Ross, und das Gros der europäischen Politiker war eher kleinlaut. Der Begriff einer «Zeitenwende» war das Eingeständnis, dass man sich beim Blick auf die zukünftige Weltordnung gründlich verkalkuliert hatte.
Nun haben die Europäer, jedenfalls ihre weit überwiegende Mehrheit, nicht nur aus humanitären Gründen dieser Ordnung, dem Frieden auf Basis einer regelbasierten Verständigung und dem Übergewicht wirtschaftlicher gegenüber militärischer Macht angehangen; sie taten das auch, weil es ihren Interessen und Fähigkeiten entsprach: Die EU hatte wirtschaftliche Macht, aber keine militärische, sie war (und ist) ein Regelgeber und Regelbewirtschafter, aber kein politischer Akteur, und man erinnerte sich mit Schrecken an die Kriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, deren Neuauflage (auch der eines Kalten Krieges) man unter allen Umständen verhindern wollte. Vor allem aber: Über wirtschaftliche Macht verfügte man und konnte sie bequem in politischen Einfluss transformieren, militärische Macht dagegen musste man erst aufbauen – und das kostete Geld, viel Geld, und würde mit erheblichen Wohlstandseinbussen verbunden sein. Das wollte man vermeiden, auch nach der russischen Annexion der Krim und dem Krieg im Donbas, auf die namentlich Deutschland und Frankreich mit einer Politik des Appeasement reagierten. Anderes wäre der Bevölkerung auch kaum zu vermitteln gewesen. Man sah den Konflikt um die Krim und den Donbas als eine postsowjetische Angelegenheit an, durch die man sich nicht von dem eingeschlagenen Weg abbringen lassen wollte. Und mit Blick auf die Weltwirtschaft konzentrierte man sich auf die Ozeane und die dort verlaufenden globalen Handelsströme und konnte sich nicht vorstellen, dass einem Binnenmeer, dem Schwarzen Meer, eine weltwirtschaftlich ausschlaggebende Rolle zufallen könnte.
Auch darin hatte man sich getäuscht. Es spricht vieles dafür, dass beim russischen Agieren gegenüber der Ukraine, von der Krim-Annexion bis zum Angriffskrieg seit Februar 2022, das Schwarze und das Asowsche Meer eine grössere Rolle spielen als das Interesse an der Schwerindustrie und den Bodenschätzen im Donbas. Durch die Fixierung auf Wirtschaftsbilanzen hatte man in Europa verlernt, sich mit geopolitischen Konstellationen zu beschäftigen. Die Konzentration auf Regelbindung, wirtschaftliche Macht und freien Welthandel sollte ja gerade den Einfluss der Geopolitik auf die Weltordnung zum Verschwinden bringen. In den USA und Russland sah man das anders: In den geopolitischen Entwürfen, die Zbigniew Brzezinski für die USA und Alexander Dugin für Russland am Ende des 20. Jahrhunderts ausarbeiteten, spielte das Schwarze Meer und seine geografische Umgebung für die Frage, wer in der Weltpolitik und der Weltwirtschaft wie viel zu sagen hatte, eine herausgehobene Rolle. In der nun entstehenden Weltordnung jedenfalls werden geopolitische Überlegungen mitsamt den daraus resultierenden Konkurrenzen und Konflikten eine sehr viel grössere Rolle spielen als in den zurückliegenden drei Jahrzehnten, in denen es um Handel und Juridifizierung ging.
Von der Wirtschaft geblendet
Das scheinen auch die Europäer begriffen zu haben, sonst hätten sie sich kaum auf das gemeinsam mit den USA verfolgte Vorhaben eingelassen, eine Wirtschaftsachse aus Schienensträngen und Schiffsrouten von der Nordsee bis zum Indischen Ozean aufzubauen, die als ökonomisch-politische Querachse zum chinesischen Seidenstrassenprojekt sowie zur russischen Militärpräsenz in Westafrika und Syrien anzusehen ist. Auch wenn man das so nicht eingestehen wird, handelt es sich dabei doch um den Einstieg der Europäer in eine Politik der Einflusszonensicherung, wie sie von den USA in der Karibik und Mittelamerika seit jeher betrieben wird, China sie über Zentralasien bis ins subsaharische Afrika seit mehr als einem Jahrzehnt betreibt und Russland sie mit Hilfe der Wagner-Söldner in der Sahelzone und im Nahen Osten verfolgt. Man kann das beklagen, muss aber zugestehen, dass dieser Kurswechsel den Europäern von China und Russland mehr aufgezwungen worden ist, als dass sie sich aus freien Stücken dafür entschieden hätten. Das Delikate daran ist, dass darin jene geopolitischen Vorstellungen wieder auftauchen, die von dem schwedischen Geopolitiker Rudolf Kjellén dem Deutschen Reich vor 1914 angesonnen worden sind und die sich dann im Projekt der Berlin-Bagdad- bzw. Hamburg-Basra-Bahn konkretisiert haben. Das war damals in Konkurrenz zu den geopolitischen Vorstellungen der Briten und der Franzosen. Jetzt soll es gemeinsam mit ihnen und unter Einbezug der USA vorangetrieben werden.
Der Strategiewechsel von der Konzeption einer freien Weltwirtschaft hin zur Sicherung von Einflusszonen hat auch mit den jüngsten Erfahrungen von der Unzuverlässigkeit globaler Handelsketten (etwa in der Covid-19-Pandemie) und der Nutzbarkeit wirtschaftlicher Abhängigkeiten als politischer Waffe zu tun: den wenig effektiven westlichen Sanktionen gegenüber Russland, vor allem aber der russischen Nutzung von Erdgas- und Erdöllieferungen als wirtschaftlichem Schutzschild für den Eroberungskrieg in der Ukraine. Die Ambivalenz wirtschaftlicher Sanktionen als Steuerungsinstrument der internationalen Politik ist den Europäern übel aufgestossen: Nachdem sie Anfang 2022 noch davon ausgegangen waren, mit Sanktionsdrohungen Putin vom Angriff auf die Ukraine abhalten zu können, haben sie durch die Drosselung russischer Energie- und Rohstofflieferungen nach Europa ihre eigene wirtschaftliche Verwundbarkeit zu spüren bekommen. Das hat nicht nur die militärische Macht als Instrument der Abschreckung wieder ins Spiel gebracht, sondern auch den Blick auf die Weltwirtschaft von der Suche nach Absatzmärkten auf die nach Energie- und Rohstoffzufuhren verändert. Zusammengenommen ist das mehr als eine «Zeitenwende»: Es ist eine tiefe Zäsur, in deren Folge, auch wenn manche sich anderes wünschen, nichts mehr so sein wird, wie es vordem war.
«Die Ambivalenz wirtschaftlicher Sanktionen als Steuerungsinstrument der internationalen Politik ist den Europäern übel aufgestossen.»
Postimperiale Phantomschmerzen
Zurück zum Krieg in der Ukraine. Er wird, allen internationalen Bemühungen zum Trotz, vorerst nicht beendet werden. Der früheste Zeitpunkt, ab dem Waffenstillstandsverhandlungen Aussicht auf Erfolg haben, sind die amerikanischen Präsidentschaftswahlen in einem Jahr. Russland wird den Krieg wohl bis dahin fortsetzen, weil es sich von einem Erfolg der Republikaner mit Trump an der Spitze eine Einschränkung der US-Unterstützung für die Ukraine verspricht, was die Ukraine zu weitreichenden Zugeständnissen zwingen würde. Und die Ukraine wird das verbleibende Jahr nutzen, um auf dem Gefechtsfeld Erfolge zu erzielen, mit denen sie die eigene Verhandlungsposition verbessern will. Den Europäern sollte klar sein, dass sie in Anbetracht der amerikanischen Unwägbarkeiten das gegenwärtige Window of Opportunity für effektive Waffenlieferungen an die Ukraine nutzen müssen. Sonst könnte die Ukraine den Krieg auch verlieren.
Eine erhebliche Rolle beim Fortgang dieses Kriegs wird freilich auch der Umstand spielen, dass sich das Kriegsgebiet inmitten einer Zone der politischen Instabilität und Konflikte befindet, die vom Westbalkan bis zum Kaspischen Meer und von der Ukraine über die Türkei bis in den Nahen Osten reicht. Historisch betrachtet handelt es sich dabei um einen Raum, der bis zum Ende des Ersten Weltkriegs von drei Grossreichen beherrscht wurde: dem Reich der russischen Zaren, dem Reich der osmanischen Sultane sowie der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Alle drei Reiche waren multinational, multikonfessionell und multilingual, und das in einer Weise, dass sich daraus keine räumlich geschlossenen Nationalstaaten nach westeuropäischem Vorbild formen liessen. Gleichzeitig entstanden bei einigen Mächten postimperiale Phantomschmerzen. Das lässt sich nicht nur in Putins Russland beobachten, sondern auch in der neoosmanischen Politik des türkischen Präsidenten Erdoğan und seinem Ziel, das Land als Grossmacht an der Schnittlinie Europas, Asiens und Afrikas zu etablieren – oder in Ungarn, wenn Ministerpräsident Orbán mitunter einen Schal trägt, der ein Grossungarn zeigt. Nimmt man noch das mit den Grenzziehungen nach Ende der jugoslawischen Zerfallskriege unzufriedene Serbien sowie die Kaukasusregion mit Georgien, Armenien und Aserbaidschan dazu, so hat man es mit einer ganzen Reihe revisionistischer Länder zu tun, die auch nach einem Ende des Kriegs in der Ukraine dafür sorgen werden, dass die Südostflanke Europas nicht zur Ruhe kommt. Der Wiederaufbau der Ukraine, wenn es sie nach dem Kriegsende dann als selbständigen Staat noch geben wird, und die politische wie wirtschaftliche Stabilisierung des Raumes zwecks Verhinderung von Kriegen wird die Europäische Union in den kommenden Jahrzehnten politisch in Anspruch nehmen und ihr viel Geld abverlangen.
Dazu wird die EU in ihrer bisherigen Form nicht in der Lage sein. Mit anderen Worten: Der Krieg in der Ukraine ist die Spitze einer Herausforderung, die eine grundlegende Reform der EU erzwingt – oder mittelfristig dafür sorgt, dass Europa weltpolitisch zu einem zweit- oder drittklassigen Akteur wird. Dann werden die schon immer vorhandenen zentrifugalen Kräfte an Stärke gewinnen, und die grossen Staaten Europas werden, auch unter rechtspopulistischem Einfluss, mehr und mehr eigene Wege gehen. Der Krieg in der Ukraine und das notorische Drohgehabe Russlands gegenüber den Europäern haben das Zeug, die EU entweder in einen politisch handlungsfähigen Akteur zu verwandeln oder aber das so hoffnungsvoll vorangekommene europäische Integrationsprojekt in einen Invaliden zu verwandeln, der in einem fort auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Was das Wahrscheinlichere ist, ist derzeit weithin offen. Auch diese Ungewissheit ist eine tiefe Zäsur gegenüber der vormaligen Zuversicht.