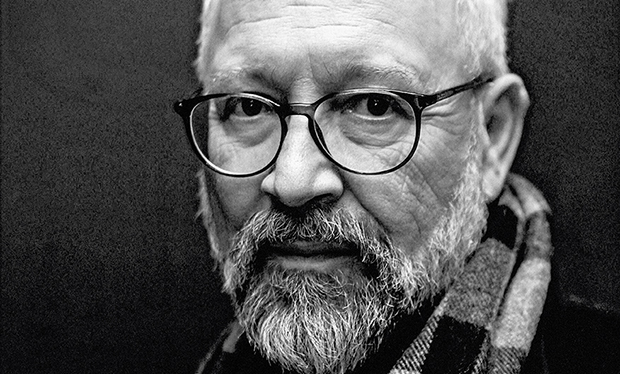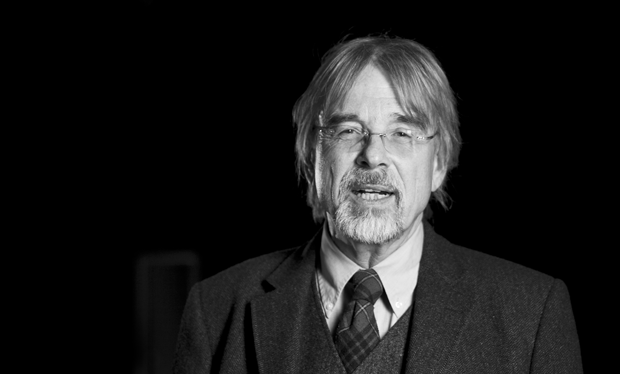Störfaktor direkte Demokratie
Die direktdemokratische Mitbestimmung in Form von Initiativen und Referenden ist bei den politischen Vertretern nicht beliebt. Sie verkompliziert die Lage und erinnert an das eigene Versagen als Repräsentant des Volkes.

Die niederländische Regierung möchte das Referendum, das erst im Sommer 2015 eingeführt wurde, wieder abschaffen. Es entspricht ihren Erwartungen nicht, denn die politischen Auswirkungen des Referendums waren weitaus grösser als gedacht: Es hatte das politische System der Niederlande geöffnet, die Macht der Regierungs- und der Parlamentsmehrheit in der Folge begrenzt und einen präventiven Effekt auf die niederländische Gesetzgebung ausgeübt. Deshalb sieht der neue Koalitionsvertrag in den Niederlanden die Abschaffung dieses «Störfaktors» vor. Tatsächlich beeinflusst die direkte Demokratie die Arbeit der Regierung und des Parlamentes erheblich. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass bei wichtigen Sachgeschäften noch jemand über ihnen steht und gegebenenfalls zu einem Vorhaben Nein sagt – die direkte Demokratie ist ein anderes Regierungsmodell als das ihnen bekannte System der repräsentativen Demokratie.
Die falsche Tür
In der Schweiz spielt im Hinblick auf das Volksinitiativrecht die Initiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs die entscheidende Rolle. Der ausgearbeitete Entwurf überlässt dem Parlament je nach Wortlaut einen geringen oder sogar gar keinen Konkretisierungsspielraum, er schlägt vielmehr einen definitiven Wortlaut vor. Da das Parlament den Text nicht ändern darf, entspricht der ausgearbeitete Entwurf ohne jede Einschränkung der Aussage des Bundesgerichts, die Volksinitiative sei nicht bloss ein Antrag aus dem Volk, sondern auch ein Antrag an das Volk. Mit dem Instrument der Volksinitiative auf Teilrevision in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs können Verfassungsnormen ohne Zutun und gegen den Willen des Parlaments von Initianten angeregt und von Volk und Ständen beschlossen werden. Der ausgearbeitete Entwurf ist deshalb die radikalere und zielsicherere Form der Volksinitiative und dementsprechend beliebter als die Initiativform der allgemeinen Anregung.
Die Komitees reichen ihre Volksinitiativen in Bern ein. Dabei ziehen das Komitee und die Unterstützer vom Bundesplatz zum Bundeshaus West, um dort, an der linken Seitentür des Platzes mit der Berna-Statue, die Kartonschachteln mit den unterschriebenen Initiativbögen abzugeben. Der Vorgang ist mittlerweile zum Ritual geworden: Angestellte der Bundeskanzlei, Sektion politische Rechte, öffnen die Doppeltür zur Hälfte, nehmen die Schachteln entgegen und quittieren den Empfang. Der Seiteneingang in das Bundeshaus West ist indes die falsche Tür, denn die Initiative richtet sich weder an die Bundeskanzlei noch an den Bundesrat, sondern an das Parlament zur Stellungnahme. Eigentlich müsste der höchste Schweizer, der Nationalratspräsident, in der Tür des Parlamentsgebäudes stehen und die Schachteln mit den Initiativbögen entgegennehmen, denn die Initiative richtet sich an das Parlament und betrifft seine Zuständigkeit. In der Folge wird die Initiative auf die Tagesordnung gesetzt. Es ist kein Zufall, dass Parlament und Bundesrat von dieser Symbolik nichts wissen wollen: Nicht nur in Holland, auch in der Schweiz stören die Initiativen den Parlamentsbetrieb – sie sind deshalb unerwünscht, ein Fall für den Nebeneingang.
Das Volksinitiativrecht des Art. 139 der Bundesverfassung (BV) richtet sich an und gegen das Parlament, denn es betrifft die zentrale Kompetenz der Bundesversammlung: die Initiative zur Verfassungsgebung. Die Volksinitiative zur Verfassungsgebung schmälert die Macht der Bundesversammlung. Anliegen, die im Parlament keine oder zu wenige Stimmen erhalten, können damit gegen den Willen des Parlaments durchgesetzt werden; der jeweils von aussen kommende Anstoss zeigt, dass das Parlament als Repräsentant des Volks potentiell versagt hat. Dies ist dann der Fall, wenn das Volk eine Initiative gegen den Willen des Parlaments annimmt.
Es ist also folgerichtig, dass die Politik das Modell der direkten Demokratie auch in der Schweiz gern kritisiert und das Volk für überfordert erklärt. Aber: wenn das Volk nicht einmal in der Lage ist, bei Sachabstimmungen «richtig» zu entscheiden, wie soll es in der Lage sein, bei Wahlen die richtigen Personen zu seinen Vertretern zu bestimmen? Es ist doch viel schwerer, eine Person richtig zu beurteilen als einen blossen Sachgegenstand. Mit anderen Worten: die Theorie des überforderten Volkes ist nichts anderes als die Gegnerschaft zur Demokratie. Die lange und erfolgreiche Praxis der direkten Demokratie in der Schweiz und in den amerikanischen Gliedstaaten beweist, dass nicht nur die repräsentative, sondern auch die direkte Demokratie gut funktioniert und eine stabile Ordnung herstellt. Die Initiative ist sozusagen ein Überdruckventil für Konflikte und Themen, die das Parlament nicht angeht. Eine vom Volk gewünschte Veränderung ist gegen den Willen des Parlaments möglich.
Die Rolle des Parlaments bei eingereichten Initiativen
Im Idealfall stammt eine Volksinitiative aus parteiferneren Kreisen, die im Parlament nicht die nötige Mehrheit besitzen und daher den Initiativweg einschlagen. Die grossen politischen Parteien besitzen über die Parlamentarier nämlich einen viel besseren Zugang zur politischen Willensbildung: Wenn sie sich um die Mehrheitsbildung bemühen, können sie zusammen mit anderen Parteien für ein Anliegen die Mehrheit erreichen und dieses dann auch im Parlament beschliessen.
Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen, dass die Parlamentarier grundsätzlich in einer Opposition zum Volksinitiativrecht stehen müssen. Denn als Parlamentarier wollen sie die Macht ihrer Körperschaft aufrechterhalten. Aus diesem Grund haben Parlament und Bundesrat die Volksinitiative im Verlauf ihrer seit 1891 währenden Geschichte oft als störend oder unnötig betrachtet. Die Klage, dass es zu viele Initiativen gebe, hängt nicht mit der Zahl der Initiativen zusammen, sondern ist der gegensätzlichen Interessenlage geschuldet. Bereits in den politisch spannungsreichen 1930er Jahren wendeten die politischen Bundesbehörden deshalb eine wirksame Methode an, die das Volksinitiativrecht von 1930 bis 1949 stark beeinträchtigte. Bundesrat und Parlament führten das Instrument der sog. Schubladisierung ein: Der Bundesrat behandelte die gültigen und mit genügend Unterschriften versehenen Volksinitiativen nicht und die Bundesversammlung legte sie dem Volk auch nicht zur Abstimmung vor. Die politischen Bundesbehörden versorgten die Initiativen in einer «tiefen Schublade» des Bundeshauses und warteten, bis der Zeitablauf das Begehren obsolet machte. 1949 deckte Zaccaria Giacometti in einem NZZ-Leitartikel diese Praxis auf, nach der die politischen Bundesbehörden insgesamt 15 Initiativen schubladisiert hatten und diese verfassungswidrige Praxis für die Zukunft legalisieren wollten. Der Bundesrat versprach nach Giacomettis heftiger Intervention, die Schubladisierung aufzugeben und alle Initiativen dem Volk vorzulegen. Das Parlament verlängerte in der Folge die Behandlungsfrist von einem Jahr auf drei Jahre, womit es zwar nicht die Schubladisierung, wohl aber die zögerliche Behandlung legalisierte. Freilich lagen auch nach 1949 noch immer «Initiativleichen» in den Schubladen des Bundeshauses. Den Rekord stellte eine Initiative der Sozialdemokraten zur Pressefreiheit von 1935 auf: Sie wurde erst 1978, also nach 43 Jahren, abgeschrieben.
Die in der Vergangenheit bestehende und bis in die Gegenwart reichende tendenzielle Ablehnung der Volksinitiative durch das Parlament zeigt sich auch daran, dass von 1891 bis 1987 ein verzerrendes Abstimmungsverfahren angewendet wurde. Das Verbot des doppelten Ja im Falle einer Abstimmung über Initiative und Gegenentwurf führte regelmässig dazu, dass die Stimmen der änderungswilligen Bürger sich aufteilten, wodurch die Initiative und der Gegenentwurf scheiterten. Es blieb also alles beim Alten.
Kurz und gut: es ist normal, dass die Volksinitiative den Eigenbetrieb des Parlaments stört und dass das Parlament immer bestrebt ist, dieses Recht auf verfassungsmässige oder – sofern nicht anders möglich – auf verfassungswidrige Weise einzudämmen. Sowohl mit Blick auf die Vergangenheit als auch mit Blick auf die Zukunft gab und wird es aufgrund der Anlage des Volksinitiativrechts immer wieder Bestrebungen geben, sie einzudämmen oder gar abzuschaffen. Zu diesen Bemühungen gehören auch die hartnäckige Suche nach neuen Ungültigkeitsgründen sowie das Bemühen, das Initiativrecht mit Hilfe des Völkerrechts kaltzustellen. Diese Bestrebungen geniessen Ansehen, denn sie wollen – vordergründig – das Völkerrecht wahren. Richtig besehen richten sie sich gegen die direkte Demokratie. Es ist nicht zu übersehen, dass sie politisch das Ansehen des Völkerrechts beschädigen. Dies äussert sich beispielsweise in der hängigen «Selbstbestimmungsinitiative», die den Einfluss des Völkerrechts mindern will. Zudem mutet es eigenartig an, dass man das politisch durchaus verständliche Bestreben, die Volksinitiative einzudämmen, mit dem Völkerrecht begründet und nicht mit dem nationalen Recht. An sich hätte es das Parlament in der Hand, mittels einer Verfassungsänderung neue Ungültigkeitsgründe vorzusehen und damit das Initiativrecht frontal anzugreifen. Dass man diesen Weg nicht zu beschreiten wagt, sondern das Völkerrecht vorschiebt, spricht für sich.
Die Verweigerung der Umsetzung von Volksinitiativen
Eine andere Methode, eine angenommene Volksinitiative leerlaufen zu lassen, besteht in der Nichtumsetzung von Volksinitiativen. War ein Volksentscheid aus der Sicht der politischen Bundesbehörden fragwürdig und hätte man ihn akzeptieren müssen, setzte man Volksentscheide nicht oder anders um. Auch das ist kein neues Phänomen: Am 28. September 1982 nahm der Verfassungsgeber überraschend und zum Ärger der bürgerlichen Parlamentsmehrheit die «Preisüberwachungsinitiative» an. Als in der Folge die Bundesversammlung das Preisüberwachungsgesetz erliess, waren alle wichtigen Preise von der Überwachung ausgenommen – die Initiative lief leer. Erst die Drohung einer weiteren (Vollstreckungs-)Initiative führte zu einem Preisüberwachungsgesetz, das diesen Namen verdiente. Dieses Vorgehen ist beliebt, weitere Beispiele dafür stellen die «Umsetzungen» der Zweitwohnungs- und der Masseneinwanderungsinitiative dar. Schon verschiedene Male kam es deshalb zur Lancierung von «Durchsetzungsinitiativen». Den Ausdruck hat zwar erst kürzlich die SVP anlässlich der (Nicht-)Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative geprägt; das Phänomen selbst ist aber älter. Angesichts der anhaltenden Verweigerung des Parlaments, Initiativen umzusetzen, muss man Folgeinitiativen als legitimes Mittel betrachten. Auch unter dem Gesichtspunkt der Umsetzung angenommener Volksinitiativen erweist sich das Parlament mitunter als Gegenpartei, die das Anliegen auch in diesem späten Stadium zu Fall bringen möchte. Hier täte eine ausgebaute Verfassungsgerichtsbarkeit not. Es braucht nicht erläutert zu werden, dass das Parlament nicht im Entferntesten an die Einführung einer auch nur begrenzten Verfassungsgerichtsbarkeit denkt.
Bedarf die Volksinitiative einer Reform?
Die aktuelle Praxis des Bundesrates (in seinen Anträgen an das Parlament) und der Bundesversammlung zur Gültigkeit von Volksinitiativen entspricht den in der Verfassung formulierten Erfordernissen. Die Bundesversammlung hat fast immer korrekt entschieden. Die Versuche, mit Hilfe von überzogenen Gültigkeitsanforderungen Politik zu machen und Initiativen zu Fall zu bringen, sind meist misslungen. Die Versuche einzelner Parlamentarier, nun plötzlich bei der Einheit der Materie einen strengeren Massstab anzulegen, sind unseriös: Denn auch ihre eigenen parlamentarischen Verfassungsvorlagen wären davon betroffen und müssten in der Folge an diesem Kriterium scheitern. Auch hierbei handelt es sich schlicht um Versuche, das Volksinitiativrecht auf eine verfassungswidrige Weise einzuschränken.
Die heutige Formulierung der Ungültigkeitsgründe von Art. 139 Abs. 3 BV ist nicht zu beanstanden und bedarf keiner Ergänzung. Momentan hat die Bundesversammlung die Kriterien anzuwenden. Die Kriterien des Art. 139 Abs. 3 BV mögen grobmaschig und wenig differenziert erscheinen. Es handelt sich jedoch bei der Bundesversammlung nicht um ein Gericht, das eine feinziselierte Praxis entwickeln kann. Ein Parlament ist wegen seiner Grösse und Arbeitsweise nur in der Lage, wenig differenzierte (Mehrheits-)Entscheide zu fällen. Aus diesem Grund passen die grobmaschigen Ungültigkeitsgründe zur Bundesversammlung, die die Bestimmung anzuwenden hat. Eine Revision dieser Gründe ist unnötig und schädlich. Will man wirklich weitere und juristisch präzise Kriterien zur Beurteilung von Initiativen einfügen, so müsste die Kompetenz, die Initiativen zu beurteilen, dem Bundesgericht übertragen werden.
Alle Versuche, das von den Parlamentariern ungeliebte Volksinitiativrecht einzuschränken oder abzuschaffen, sind so lange legitim, wie sie auf dem Wege der formellen Verfassungsrevision erfolgen. Die viel häufigeren Versuche, die Initiativen durch Verfassungsbeugung (z.B. Schubladisierung, überzogene Gültigkeitsanforderungen, Einsatz des nichtzwingenden Völkerrechts als Barriere gegen die Initiativen usw.) einzudämmen, stellen Verfassungsbrüche dar und sind unzulässig.
Der Sinn der direkten Demokratie besteht darin, dass sich die politische Ordnung nicht nur theoretisch, sondern auch und vor allem konkret auf das Volk abstützt. Die dargestellte Konfliktlage im Zusammenhang mit den Volksinitiativen belegt die nicht zu vermeidende Tatsache, dass es beim sog. Repräsentativsystem zu einer Elitenbildung, d.h. zu einer Art Vormundschaft, kommt. Die «Volksvertreter» sind staatsrechtlich keine Vertreter, da sie nur ihrem eigenen Gewissen verpflichtet sind. In der Sache verfolgen sie hoffentlich Volksinteressen, gewiss auch Eigen- und Drittinteressen. Es besteht die Gefahr, dass sich die politischen Behörden vom Volk abkoppeln und eine für sie angenehme Herrschaft ausüben. Die Skandale mit überrissenen Parlamentarierentschädigungen in verschiedenen Staaten Europas und der Europäischen Union belegen diese Tatsache. Die direkte Demokratie stellt eine Barriere gegen den Egoismus der politischen Eliten dar. In ihr ist die Regierung mehr als in jedem anderen Regierungssystem ein «government of the people, by the people, for the people» (Abraham Lincoln). Die holländische Regierung ist in ihrem aktuellen Bestreben, das Referendum abzuschaffen, mit diesem Diktum nur teilweise einverstanden. Sie bestätigt damit die Tatsache, dass das Volk beim Regieren stört.