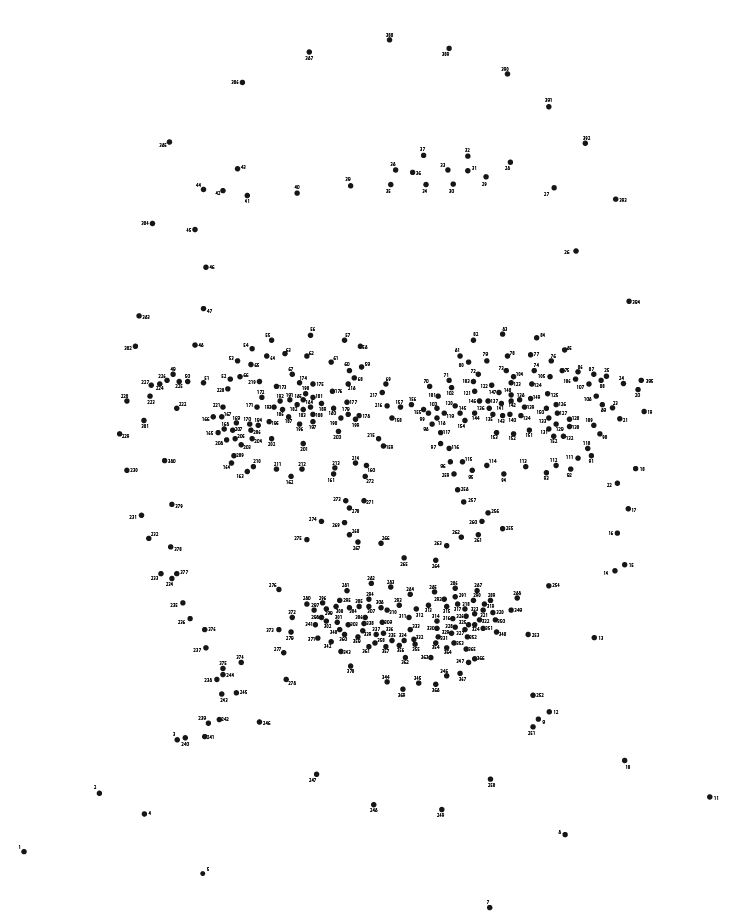Georgisch, glücklich – und (fast) gesetzlos
Der Unternehmer und ehemalige georgische Landwirtschaftsminister Mikheil Svimonishvili weiss, was sein Land vorangebracht hat: Flat Tax, Rechtsstaat, Rückbau der Verwaltung – und fehlende Hygienevorschriften.

«The Economist» hat vor einiger Zeit geschrieben, dass sich Georgien «als Star des Kaukasus» neu erfunden habe. «Die Polizei lässt sich nicht schmieren, und Elektrizität ist kein Luxus mehr. Aber am wichtigsten ist, dass die Leute selbst über solchen Erfolg nicht länger erstaunt sind. Die grösste Veränderung spielte sich in den Köpfen ab.» Stimmen Sie mit der Einschätzung überein oder zeichnet das britische Magazin ein zu schönes Bild Ihres Landes?
Die georgischen Bauern waren schon zu Sowjetzeiten ausgeprägte kleine Kapitalisten, die im Stillen und Privaten geschäfteten. Dieser Wille der Leute, etwas aus sich und aus ihrem Land zu machen, den gab es. Und den gibt es. Dabei lag es nahe, auf unternehmerfreundliche Bedingungen zu setzen. Damit werden neue Opportunitäten für die Georgier geschaffen, aber zugleich auch für alle anderen im Kaukasus, die ein Business aufziehen wollen. Unsere Situation ist mit jener der Schweiz vergleichbar: In Georgien haben wir ausser Mangan kaum Rohstoffe, aber wir haben fleissige Leute, und das Land liegt geostrategisch goldrichtig. Wer die Geschichte kennt, weiss: Die Seidenstrasse von China nach Europa führte direkt durch Georgien. Wir wollen wieder zu jenem blühenden Handelsplatz werden, den wir einst waren.
Das klingt nach politischem Programm. Zwei Jahre waren Sie selbst Agrarminister, sonst kennt man Sie aber vor allem als Unternehmer und CEO des grössten georgischen Mineralwasserunternehmens. Der unbedarfte ausländische Beobachter würde sagen: Unternehmertum und Regierungsverantwortung liegen in Georgien gefährlich nahe beieinander.
Ich weiss. Europäische Ohren sind sehr sensibel. Aber ich kann Sie beruhigen: Der Staat hat die Wirtschaft in die Privatheit entlassen, und die wirtschaftlichen Akteure wissen die neue Freiheit zu schätzen. Das neue Georgien ist ein extrem junges Land – es wurde nicht 1848 gegründet wie die Eidgenossenschaft, sondern 2004, nach der Rosenrevolution. Zuvor galt trotz frisch gewonnener Unabhängigkeit im Jahre 1991 in der Tat das pseudobiblische Motto: Die neue Situation ist bloss alter sowjetischer Wein in neuen postsowjetischen Schläuchen.
Ist das neue Georgien bloss die Idee einer politischen Elite? Oder findet es auch Rückhalt in der breiten Bevölkerung?
Fast alle georgischen Bürger stehen dahinter. Nach Jahren der Misswirtschaft wollen sie endlich die Chance nutzen, um ihr Leben in Georgien zu verbessern.
Wenn Sie unternehmerische Zwischenbilanz ziehen: Wo steht das Land heute, zehn Jahre nach dem Neubeginn?
Wir haben unsere Institutionen in Rekordzeit radikal reformiert, die Bürokratie ist minimal, der Staat selbst für mitteleuropäische Verhältnisse sehr transparent, die Eigentumsrechte wurden gestärkt. Aber all das reicht nicht. Wenn man uns in Europa und dem Rest der Welt kaum kennt, so ist dies unser Versäumnis. Wir sind erst daran zu lernen, unsere Errungenschaften auch überzeugend zu vermarkten. Aber ich denke, wir sind bereit, die Prüfungen zu bestehen, die westliche Kapitalgeber und Regierungen von uns verlangen.
Georgien als unternehmerischer Hub im Kaukasus?
Auch – aber nicht nur! Natürlich wollen wir die Verwaltungszen-tralen und Firmensitze internationaler Konzerne anziehen. Wir wollen aber auch neue Produktionsstätten ansiedeln. Es ist eine Herkulesaufgabe und braucht viel Zeit, neues Kapital aufzubauen. Unsere Leute sind gut qualifiziert, sie werden an Business Schools auf Managementaufgaben vorbereitet, die Anstrengungen im Bildungsbereich sind enorm. Georgien hat in den letzten Jahren viel in die Infrastruktur investiert, Strom, Wasser, Gas, Strassen. Dank dem Anschluss ans Schwarze Meer und guter Verkehrswege über Land können wir einerseits in die boomenden benachbarten Länder exportieren, aber auch darüber hinaus – in die ganze Welt.
Das klingt ambitioniert, aber Hand aufs Herz: Wie steht’s um die Korruption?
Seit zehn Jahren habe ich keinen einzigen Dollar verwenden müssen, um jemanden zu schmieren – weder einen Polizisten noch einen Finanzbeamten. Das war in den 1990er Jahren unter Shevardnadze noch ganz anders. «The Economist» hat recht, wenn die Zeitschrift von Luxus spricht: Wer damals zuverlässig Strom wollte, musste dafür extra bezahlen. Wer mit dem Staat in Kontakt kam, musste die Beamten gnädig stimmen. Jobs, die mit öffentlicher Macht verbunden waren, waren sehr begehrt; sie versprachen eine Extrarente.
In Europa verläuft das politische Leben in etablierten Bahnen, selbst Minireformen brauchen Jahre, zuweilen Jahrzehnte. Ein radikales Reformprogramm, wie es sich die Georgier verpassten, ist vor diesem Hintergrund nicht einmal vorstellbar. Wie haben die Bürger reagiert?
Im Grunde gab es einen impliziten Konsens: entweder wir packen’s jetzt oder wir packen’s nimmermehr. Das Tempo war kein Problem, sondern eine Chance, viele Reformen wurden über Nacht durchgezogen.
Über Nacht – wie meinen Sie das?
Ich meine das ganz buchstäblich. Zum Beispiel wurden von einem Moment auf den anderen alle Polizisten entlassen, alle! Denn wir haben schnell gemerkt, dass wir nur so der tief verwurzelten Korruption Herr werden konnten. Es dauerte einige Zeit, bis wieder neue Polizeikräfte im Einsatz waren. Georgien musste also drei Monate ohne die Gesetzeshüter auskommen. Und Sie werden es nicht glauben: Das Land funktionierte reibungslos, die Delikte nahmen nicht zu, sondern ab. Uns allen in der Regierung war bewusst: Wir haben ein Zeitfenster von ein paar Jahren, in denen alles möglich ist. Danach beginnen die strukturkonservativen Kräfte wieder überhandzunehmen.
Ziemlich mutig. Oder verrückt. Die Leute begehrten nicht auf?
Im Gegenteil. Sie standen voll dahinter, denn sie waren es ja, die am meisten unter der Korruption litten. Ein anderes Beispiel, das Eingang in die Geschichtsbücher gefunden hat und in mein Ressort als Landwirtschaftsminister fiel: Wir haben auf einen Schlag sämtliche Lebensmittel- und Hygienevorschriften abgeschafft. Denn unter Shevardnadze spazierten die Lebensmittelkontrolleure von Restaurant zu Restaurant und kassierten von deren Besitzern jeweils ein schönes Sümmchen, wobei sie ihnen im Gegenzug grosszügigerweise die Betriebslizenz weiterhin gewährten. Wer diese Form des Amtsmissbrauchs bekämpfen wollte, musste erst mal die Gesetze beseitigen, die den Beamten so viel Macht gaben.
Es herrschte für kurze Zeit also der reine Markt. Wie entwickelte sich das Experiment?
Zu unserer Zufriedenheit. Der Restaurantbesitzer will seine Kunden ja nicht vergiften, sondern sie durch ein besonders gutes und schönes Ambiente in sein Lokal locken, damit sie ihm freiwillig sein Geld überlassen. Ich vertraue jederzeit lieber dem Eigeninteresse des Restaurantbesitzers als der angeblichen Gemeinwohlorientierung eines Beamten. Unsere Massnahmen haben jedenfalls gewirkt. Die Restaurants waren erstmals wirklich sauber und die Beamten kassierten kein Schmiergeld mehr.
Warum hat Georgien später die Vorschriften wieder eingeführt, wenn alles wunderbar lief?
Es reicht leider nicht, wenn die Georgier wissen, dass die Hygiene in Georgien auch ohne Hygienevorschriften bestens funktioniert. Wir wollen ja mit anderen Wirtschaftsräumen kooperieren, und darum haben wir neue Standards etabliert. Sie waren maximal simpel und nachvollziehbar und erst noch mit EU-Richtlinien kompatibel.
Die EU soll auch Absatzmarkt für die Produkte Ihrer Unternehmer werden, seit Juli stehen erste Freihandelsabkommen. Das Unternehmen selbst ist eine georgisch-schweizerische Kooperation. Wie kam es dazu?
Mein Vater führte in den 1990ern immer mal wieder westliche Touristen, die Georgien näher kennenlernen wollten, durch das Land. 1997 war Thomas Diem unter ihnen, ein Schweizer Arzt und Psychiater, den die georgische Musik faszinierte. Sie fuhren in das Gubazouly-Tal, um einen alten Mann aufzusuchen, der noch sehr traditionelle georgische Lieder kannte. In dem kleinen Dorf Nabeghlavi gab es eine Mineralquelle, seit Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt. Sie sicherte den Bewohnern einst das Auskommen, lag jedoch seit Jahren brach. Thomas Diem wollte helfen, und er erkannte unsere Bereitschaft, etwas zu bewegen. So erwarben wir die Quelle gemeinsam für 40 000 Dollar vom Staat. Wir begannen mit fünf Leuten im Dorf. Heute hat die gesamte Unternehmensgruppe 1000 Mitarbeiter.
Das klingt nach der Karriere eines Selfmademan. Lief sie tatsächlich so ab?
Ich hatte den nötigen Ehrgeiz, das stimmt. Der erste Businessplan bestand aus drei hingekritzelten Seiten von Gia Gogoladze, meinem Geschäftspartner. In den folgenden Jahren investierten wir viel in offensives Marketing. Ohne die Unterstützung durch Schweizer Freunde hätten wir jedoch nicht expandieren können; ich verfügte damals über kein Kapital. Sie haben es mir auch ermöglicht, 1998 und 1999 an der Universität Zürich zu studieren. Ich habe damals viele schweizerische Mineralwasserproduzenten besucht, von Migros bis Rivella, und stets standen mir die Türen offen. Ich habe helvetische Standards in der Organisation, Führung und Rechnungslegung meiner eigenen Firmen übernommen. Ich lernte Zuverlässigkeit, Transparenz und Kompetenz zu schätzen.
Sind Sie mit dem Geleisteten zufrieden?
Ich schlafe bis heute nicht besonders viel, aber die Aufgabe, die ich mir selbst gegeben habe, erfüllt mich. Ich habe eine tolle Familie, ich arbeite mit guten Leuten zusammen. Insofern – ja, ich bin zufrieden. Aber ich will natürlich mit meinen Firmen weiterwachsen.
Wie kam es, dass Sie als ambitionierter Mineralwasserfabrikant mit 26 Jahren zum Landwirtschaftsminister berufen wurden?
Ganz einfach: Mikheil Saakashvili hat mich am Telephon um ein Treffen gebeten und mich direkt gefragt. Wir waren eine Generation junger Wilder, Tbilisi ist überschaubar, und alle sind zumeist über ein paar Ecken miteinander bekannt. Saakashvili hielt Ausschau nach neuen Leuten, die frei von sowjetischen Seilschaften waren, über einen Leistungsausweis und westliche Erfahrung verfügten. Aus geschäftlicher Sicht war es kein kluger Entscheid, das Ministerium zu übernehmen – die Firma stagnierte in den beiden Jahren, ich hatte meine Aktien vor dem Amtsantritt meinem Vater überschrieben und die Leitung abgegeben. Allerdings hat sich der Ausflug in die Politik dennoch gelohnt; ich wollte meinem Land dienen, es voranbringen, und ich denke, das ist mir und meinen Mitstreitern gelungen.
Sie haben nie einen Anflug von Zweifel verspürt, der Aufgabe als Agrarminister nicht gewachsen zu sein?
Ich habe mir gesagt: Wer den Ehrgeiz hat, ein Unternehmen aufzubauen, kann auch ein Ministerium führen. Und so leitete ich von einem Tag auf den anderen ein Amt mit 6000 Mitarbeitern. Wobei allen klar war, auch den Angestellten selbst: sie hatten eigentlich nichts zu tun. Ich habe viele schlaflose Nächte verbracht, als ich mir Gedanken über Liberalisierungs- und Privatisierungsschritte machte.
Mit welchen Konsequenzen?
Ich habe 5000 Leute nach Hause geschickt und wurde selbstredend auch stark angefeindet. Traktorfahrer und Ärzte waren fortan keine Beamten mehr, sondern ganz normale Bürger, die auf eigene Rechnung zu wirtschaften hatten. Aber ich wusste, dass ich das Richtige tat.
Warum haben Sie später Ihre politischen Ambitionen begraben?
Ich bin kein Verwalter. Mich interessieren Fabriken, Ideen, Maschinen. In den wilden Jahren konnte ich in der Politik viel bewegen. Heute wäre das schon schwieriger, mir fehlt für die Taktiererei die Geduld.
Sind Sie 2006 freiwillig aus dem Amt geschieden?
Saakashvili hat die Regierung umgebaut – der Grund war ein persönlicher Konflikt des Präsidenten mit dem Verteidigungsminister. Ich war unter den dreien, die gehen mussten. Alles verlief korrekt, Saakashvili bat mich um ein Gespräch, ich willigte ein. Es war mir gerade recht. Ich hatte meine Pflicht getan und konnte mich wieder um mein Unternehmen kümmern.
Keine Enttäuschung?
Absolut nicht. Das ist eben der Unterschied. In Europa ist ein Minister, der entlassen wird, plötzlich arbeitslos. In Georgien sind die Minister froh, dass sie wieder ihren Geschäften nachgehen können.
Sowohl Saakashvili als auch Ivanishvili, sein politischer Widersacher, ehemaliger Premierminister und Initiant des herrschenden Regierungsbündnisses, sind pro Marktwirtschaft und Unternehmertum. Gibt es in Georgien überhaupt Sozialdemokraten nach europäischem Vorbild?
Klar, die gibt es, auch in der aktuellen Regierungskoalition, allerdings sind sie nicht besonders stark. Zu ihnen zählen viele Künstler und Filmemacher. Sie waren in der Sowjetunion privilegiert, hatten Datschas und Autos, und sie hätten ihre Privilegien gerne zurück.
Bekommen Sie als Ex-Minister eine Pension vom Staat?
Nein, keinen Rappen. Das gehört sich auch nicht. Es gibt keinen Grund, Politiker zu privilegieren.
Wie lange braucht man in Georgien, um ein Unternehmen zu gründen?
Ein paar Stunden.
Wie lange braucht man, um eine Steuererklärung auszufüllen?
Das läuft alles elektronisch. Man braucht keinen Treuhänder. Dank Flat Tax ist die ganze Prozedur maximal einfach.
Eine Flat Tax ist im alten Europa nicht mehrheitsfähig. Wer mehr verdient, soll nicht nur absolut, sondern auch relativ mehr in den gemeinsamen Topf einzahlen – die sozialistische Idee der Steuerprogression wird auch von nominell bürgerlichen Politikern nicht in Frage gestellt.
Das ist mir ein Rätsel. Ich kann mir das Regime der Steuerprogression nur so erklären, dass sich Zentraleuropa in einer anhaltenden Wohlstandsblase befindet. Gerade als Unternehmer muss ich sagen: Ich trage zusammen mit den anderen Eigentümern das Risiko des Verlusts; ich schaffe Arbeitsplätze, was ja die sozialste Politik ist, die man sich vorstellen kann, und ich bezahle viele Steuern. Damit bringe ich das Land voran, und das Land hat das grösste Interesse, mich in meinem Tun nicht zu behindern. Heute haben wir diesen Konsens in Georgien. Aber mir ist auch klar: Sollte es Georgien einst wirtschaftlich so gut gehen wie Deutschland oder der Schweiz, dürften die Leute ebenfalls auf die Idee kommen, die Steuerprogression einzuführen. Das ist ein Denken, das man sich leisten können muss.
Welches waren die Vorbilder für die Reformagenda in der Regierung Saakashvili?
Wir gingen sehr eklektisch vor. Wir nahmen das Beste aus den USA, aus der Schweiz, aus Israel, aus Singapur. Je nach Fall, je nach Gesetz.
Wie zuverlässig sind heute Rechtsstaat und Demokratie in Georgien?
Es kommt auf den Massstab an. Vergleichen wir unsere Demokratie mit Russland, Aserbaidschan oder Kasachstan, sind wir schon sehr weit gekommen – die letzten Wahlen brachten neue Leute an die Macht, der Regierungswechsel verlief friedlich und reibungslos. Wir haben keine Familienclans, die die Politik beherrschen, es finden keine Rachefeldzüge statt. Blicken wir hingegen in die Schweiz, so bleibt noch viel zu tun; das Niveau der politischen Debatte, zuverlässige Parteien, aktive Bürger, daran müssen wir noch arbeiten. Was den Rechtsstaat angeht, so funktioniert er tadellos, die Richter sind nicht bestechlich. Und die Juristen, die für den Staat arbeiten, sind gut ausgebildet, viele im Westen.
Stellen Sie Verwandte in Ihrer Firma an, die auf Jobsuche sind?
Nur wenn sie gut sind.
Keine Gefälligkeiten innerhalb der grossen georgischen Familie?
Nein. Die Zeiten sind vorbei. Ich habe stets ein offenes Ohr für Leute, die etwas leisten wollen. Aber ich verteile keine Familienrenten.