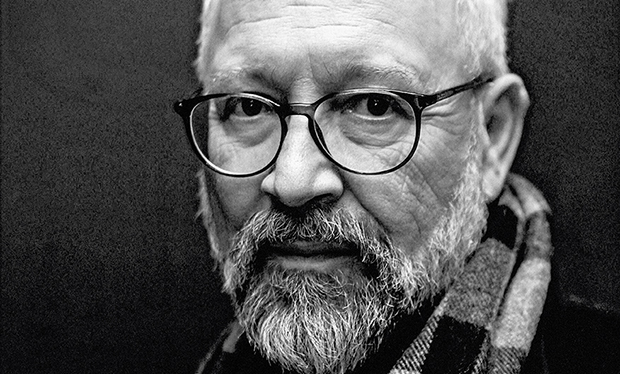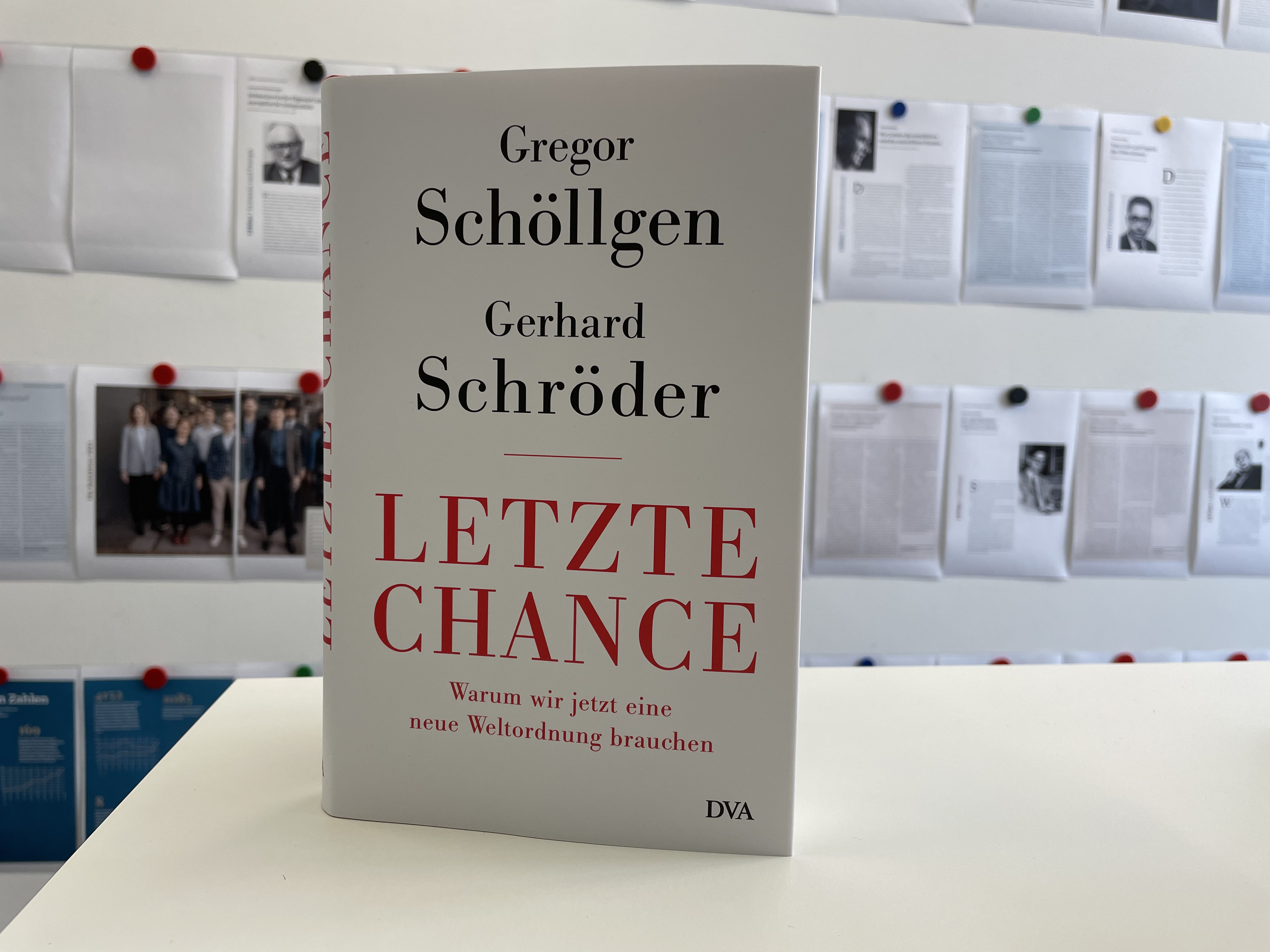Die freiheitliche Ordnung
Die Demokratie wird im Allgemeinen als die einzige auf Dauer zuverlässige politische Sicherung individueller Freiheit angesehen. In der Geschichte des politischen Denkens begriff man das Verhältnis meist aber erheblich kritischer. Eine Einführung.

Die individuelle Freiheit, die von der Freiheit eines politischen Verbands gegenüber anderen politischen Gemeinschaften zu unterscheiden ist, hat man im 18. und 19. Jahrhundert in einer konstitutionellen Monarchie besser geschützt gesehen als in einer Demokratie, wo viele politische Theoretiker die Freiheit des Einzelnen der Willkür des Volkswillens ausgeliefert glaubten. Einen Monarchen auf Vernünftigkeit festzulegen, hielt man für sehr viel leichter möglich, zumal dann, wenn dem Herrscher noch ein Parlament zur Seite gestellt wurde, als den Willen des Volkes vernünftig zu machen; bei dem befürchtete man, er könne jederzeit über die Stränge schlagen. Die Denker der Aufklärung, die sich die Herrschaft der Vernunft auf ihre Fahne geschrieben hatten, waren, sieht man von ganz wenigen Ausnahmen ab, keine Freunde oder Anhänger der Demokratie.
Die Tyrannei der Mehrheit
Paradigmatisch dafür wurde die von Alexis de Tocqueville in seinem Amerikabuch ausgesprochene Warnung vor einer «Tyrannei der Mehrheit», womit Tocqueville die ungezügelte Demokratie meinte. Tocqueville hatte die Schreckensjahre der Französischen Revolution im Gedächtnis, als er die USA bereiste und sich dort mit der Frage beschäftigte, wie es den Amerikanern gelungen war, den Volkswillen vernünftig zu machen und dessen Willkür zu zügeln. Das war im übrigen auch eine Frage, mit der sich die Gründerväter der Vereinigten Staaten selbst intensiv beschäftigt hatten und zu der die Federalists, die der Gründung eines Bundesstaates gegenüber einem Staatenbund der dreizehn unabhängig gewordenen Kolonien den Vorrang gaben, das Argument beisteuerten, die Willkür des Volkes komme in kleinen politischen Verbänden sehr viel eher zum Tragen als in grossen Staaten. Die Grösse eines Landes wirke wie ein Filter der Unvernunft, und das komme schliesslich auch der Sicherung individueller Freiheit zugute.
«Die Denker der Aufklärung, die sich die Herrschaft der Vernunft auf ihre Fahne geschrieben hatten, waren, sieht man von ganz wenigen Ausnahmen ab, keine Freunde oder Anhänger der Demokratie.»
Die Vorstellung von der Unvernunft des Volkes wiederum gründete sich im in der Literatur überlieferten Bild der antiken Demokratie, zumal der Demokratie in Athen: Das Todesurteil gegen Sokrates, die Verbannung all derer aus der Stadt, die im Verdacht standen, sich der Partei des Demos entgegenstellen zu wollen, dazu die notorische Neigung der athenischen Volkspartei, den Bündnerstädten bedingungslos den eigenen Willen aufzuzwingen, und schliesslich die hemmungslose Kriegspolitik, die von den Athenern gerade in der Epoche der Demokratie betrieben wurde – all das waren Markierungen auf dem Kerbholz der Demokratie, die nahelegten, in ihr keinen Garanten der individuellen Freiheit zu sehen.
Um einiges besser stand in dieser Frage die römische Republik da, wo sich die Volkspartei gegen die Aristokraten nicht durchgesetzt hatte, sondern beide im Zusammenwirken miteinander die Macht ausübten und sich dabei wechselseitig in Schach hielten. Seit Cicero wurde die römische Republik als Mischverfassung dargestellt, in der monarchische, aristokratische und demokratische Elemente miteinander eine Verbindung eingegangen waren. Doch dann war die Republik in einem Bürgerkrieg zwischen Volkspartei und senatorischem Adel untergegangen. Seitdem war die republikanische Idee mit dem Makel des Bürgerkriegs behaftet, den sie nicht beseitigen, sondern nur relativieren konnte, indem sie darauf verwies, dass auch andere politische Ordnungen in Bürgerkriegen zugrunde gegangen waren.
Die Drohung des Bürgerkriegs war fast noch schlimmer als die der Tyrannis, vor der zu schützen der Anspruch einer demokratischen Republik war. Gegen diese Selbstlegitimation hatte sich Tocquevilles Warnhinweis von der möglichen Verbindung zwischen Demokratie und Tyrannis in Gestalt einer «Tyrannei der Mehrheit» gerichtet. Und diese Warnung war gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch einmal dadurch verstärkt worden, dass Friedrich Engels die Auffassung vertrat, die «Diktatur des Proletariats» sei letzten Endes nichts anderes als das Ergebnis der egalitären Demokratie, insofern in ihr die Proletarier die Mehrheit der Wähler stellten. Zusätzlich zur Tyranniswarnung geriet die Demokratie damit in den Verdacht, ein politisches Instrument zur Umgestaltung der Eigentumsverhältnisse in grossem Stil zu sein – und beides brachte sie in noch grössere Distanz zu dem uneingeschränkten Vertrauen, sie sei ein Garant individueller Freiheit.
Die Tugend der Bürger
In seinem eigenen Selbstverständnis hatte der demokratische Republikanismus ohnehin grösseren Wert auf die Tugend der Bürger als auf den Schutz der individuellen Freiheit gelegt. Das Projekt einer demokratischen Republik, so die Grundannahme des Republikanismus, hat nur dann eine Chance auf dauerhaften Bestand, wenn die Bürger sich für die Verwirklichung des Gemeinwohls in die Pflicht nehmen lassen und dabei bereit sind, ihre jeweiligen Eigeninteressen hintanzustellen. Tugendhaftigkeit bedeutete, dass sie dies freiwillig taten und nicht dazu gezwungen werden mussten. Tugend als sozialmoralische Basis einer republikanischen Ordnung war demnach der freiwillige Verzicht auf beliebigen, zumal willkürlichen Gebrauch der Freiheit. Zwar wird diese auch in einer dezidiert liberalen Ordnung eingeschränkt, sobald sie mit der Freiheit eines jeden anderen in Konflikt gerät, aber diese Einschränkung erfolgt auf der Grundlage von Gesetzen. Die Erwartung bürgerschaftlicher Tugend hingegen geht über die liberale Form der Selbstbegrenzung weit hinaus: Sie nimmt den Betreffenden in die beständige Pflicht, seine Eigeninteressen gegenüber dem Gemeinwohl des politischen Verbandes hintanzustellen.
Die demokratische Republik konnte den Bürgern zwar zusichern, sie vor der Herrschaft eines tyrannischen Autokraten oder der Ausplünderung durch eine Reihe von Oligarchen schützen zu können, aber sie machte sogleich die Gegenrechnung auf, und die bestand in der kontinuierlichen Bereitschaft der Bürger, sich für die Belange des Gemeinwesens nicht bloss zu interessieren, sondern auch zu engagieren. Sprich: Zeit und Kraft, Ressourcen und Ideen einzusetzen, um den Fortbestand der republikanischen Ordnung zu gewährleisten und für sie einzustehen. Im Unterschied dazu räumten die politischen Ordnungen, an deren Spitze ein Einzelner oder einige wenige standen, von Anfang an Dispens ein: die Bürger müssten sich nicht um die schwierigen Fragen der Lenkung und Verwaltung des Gemeinwesens kümmern, sondern könnten sich voll und ganz auf ihre eigenen Angelegenheiten konzentrieren. In gewisser Hinsicht war (und ist) das auch ein Freiheitsversprechen, eines, das von den Mühen und Lasten politischer Partizipation dispensiert und das, wenn man so will, gegen die Grundvoraussetzungen der Demokratie gerichtet ist. Es ist ein Versprechen, von dem Etienne de La Boètie, der Freund Montaignes, meinte, es bilde die Grundlage für jene «freiwillige Knechtschaft», die er beim Aufstieg der absolutistischen Monarchie in der frühen Neuzeit allenthalben beobachten zu können glaubte. Der Dispens von der Sorge um die Staatsgeschäfte war so attraktiv, dass sich die Bürger ohne grösseren Widerstand und zumeist sogar freiwillig in Untertanen verwandeln liessen.
Positive und negative Freiheit
Isaiah Berlin, der grosse englische Ideenhistoriker, hat mit Blick auf das 20. Jahrhundert und dessen politische Verwerfungen dann zwischen positiver und negativer Freiheit unterschieden und dabei eine La Boèties Urteil entgegengesetzte Wertung vorgenommen. Berlins Wertschätzung der negativen Freiheit hatte nicht zuletzt mit den Verführungskünsten totalitärer Bewegungen und der Verführbarkeit der Menschen durch die suggestiven Versprechungen der Totalitarismen zu tun. Negative Freiheit war für Berlin die Freiheit von etwas, und insofern war sie weitgehend identisch mit dem, was allgemein als die liberale Freiheitsidee angesehen wird: Es gibt keinerlei in die Freiheitsvorstellung eingeschlossene Verpflichtungen oder Erwartungen, sondern der Freiheitsbegriff steht in einem unmittelbaren Sinn dafür, dass man sich ungehindert und ungestört seinen eigenen Präferenzen widmen kann, solange dadurch nicht die Chancen anderer, ebenfalls ihren Präferenzen nachzugehen, eingeschränkt werden. In der Idee der positiven Freiheit, der Freiheit zu etwas, sieht Berlin dagegen sogleich die Zumutungen und Nötigungen, die auftauchen, sobald es um die Verwirklichung grosser und hehrer Ziele geht. Freiheit, so Berlins Verdacht, ist dann kein Wert mehr an sich und für sich selbst, sondern die Voraussetzung für etwas anderes, das diese Freiheit schon bald aufzehrt und zunichte macht. Das war mit Blick auf die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts gedacht, die zwar immer wieder von Freiheit gesprochen hatten, aber nur, um sie sogleich wieder einzukassieren oder als etwas in seinem ganzen Umfang erst in Zukunft zu Realisierendes zuzulassen. Die Wirklichkeit der Freiheit wurde auf diese Weise aus dem Erfahrungsraum in den Erwartungshorizont verschoben. So störte sie das Treiben der Politiker nicht. In seiner Präferenz für den liberalen Freiheitsbegriff ging es Isaiah Berlin somit darum, das Stör- und Widerspruchspotenzial von Freiheit sicherzustellen.
Aber hat er damit womöglich, wie seine Kritiker gegen ihn eingewandt haben, «das Kind mit dem Bade ausgeschüttet»? Denn auch wenn zutrifft, dass positive Freiheit im Hinblick auf das Wozu missbraucht werden kann, bleibt doch die Frage, wer denn der Garant der negativen Freiheit sein solle, wenn dies nicht die von ihr profitierenden Bürger selbst sind. Die Vertragstheoretiker, die den liberalen Freiheitsbegriff als ersten in die Geschichte des politischen Denkens eingespeist haben, waren tatsächlich der Auffassung, dass sich ein Hüter dieser Freiheit finden lasse, der mit den Behüteten nicht identisch sei und auch nicht identisch sein dürfe. Das war die grundlegend neue Idee, die das Verfassungsdenken der Neuzeit vom antiken Republikanismus und der klassischen Idee der Demokratie unterscheidet. Der demokratische bzw. republikanische Freiheitsbegriff der Antike hatte in Beantwortung der Frage nach den Beschützern dieser Freiheit darauf bestanden, dass dies nur die Bürger selbst sein könnten, weil allein sie als deren Nutzniesser ein elementares Interesse an der Bewahrung der Freiheit hätten. Indem Aristoteles die bürgerschaftliche Ordnung als Einheit von Herrschen und Beherrschtwerden definierte, bestand er damit, wenn auch unausgesprochen, darauf, dass sich negative und positive Freiheit nicht voneinander trennen liessen, sondern eine unauflösliche Einheit bildeten.
Das änderte sich mit den Theoretikern des Gesellschaftsvertrags, mit Thomas Hobbes und John Locke, die nach Möglichkeiten suchten, wie sich die Freiheit der Bürger gewährleisten liess, ohne dass diese sich selbst partizipativ an der Leitung des politischen Verbandes beteiligen mussten. Darin bezogen Hobbes wie Locke Position gegen das antike Freiheitsideal, das zumal von Thomas Hobbes für die politischen Wirren seiner Gegenwart verantwortlich gemacht wurde: Es seien die aus der antiken Philosophie stammenden falschen Vorstellungen von Freiheit gewesen, die zum Bürgerkrieg in England zwischen 1640 und 1660 geführt hätten. Aber einer blossen Niederwerfung der Aufständischen und der Errichtung eines absolutistischen Regimes der Stuartkönige wollte Hobbes so ohne weiteres doch auch nicht das Wort reden. Die Lösung, die er zwischen einem Zustand des latenten Bürgerkriegs und einer repressiven Herrschaft ohne freiheitsverbürgende Rechte fand, war die eines Gesellschaftsvertrags, den jeder mit jedem schloss und worin ein jeder auf sein ursprüngliches Recht auf alles verzichtete, um zu verhindern, dass er sich in einem permanenten Kriegszustand befand, weil jeder andere ebenfalls ein solches Recht auf alles hatte. Erst die Einsetzung eines Souveräns, der diesen Abtretungsvertrag nicht schloss und so zu dessen Meistbegünstigtem wurde, brachte einen Hüter der durch Verzicht gestifteten Ordnung hervor, der, weil er von den Bürgern als solcher eingesetzt war, diese nicht als seine Feinde betrachtete, nicht unterdrückte und ausplünderte, sondern ihnen negative Freiheitsrechte gewährte und diese auch sicherstellte. John Locke ging dann noch einen Schritt weiter, indem er dem durch einen hypothetischen Vertrag eingesetzten Herrscher ein Parlament als Garant der Vertragstreue zur Seite gestellt wissen wollte.
Man kann die weitreichende Bedeutung dieser theoretischen Konstruktion kaum überschätzen: Erstmals wurde hier eine politische Ordnung entworfen, in der sich das, was vordem als reine Machtfrage angesehen wurde, in eine Rechtsfrage verwandelte. Das war der Ausgangspunkt für die Konstitutionalisierung einer politischen Ordnung, mit der die Gewährleistung der liberalen Freiheit ohne gleichzeitige Absicherung durch eine republikanische Freiheit möglich sein sollte. Der Vertrag zwischen Herrscher und Untertanen, der sukzessive zu einer Verfassung ausgestaltet wurde, wurde zur Geburtsstunde einer Vorstellung von negativer Freiheit, die man schlichtweg konsumieren konnte, ohne gleichzeitig in die politische Ordnung investieren zu müssen. Freilich hatte diese Konstruktion zwei Voraussetzungen, die keineswegs als selbstverständlich vorauszusetzen waren: dass nämlich beide Seiten mit diesen Verzichten und Bindungen einverstanden waren bzw. ihre eigene Vernunft an der Vernünftigkeit dieser Verfassung ausrichteten.
Für die Vernunft des Herrschers sollte die Fülle der ihm übertragenen Macht sorgen, die er gefährdete, wenn er die Verfassung in Frage stellte. Für die Vernunft der Bürger sollte sorgen, dass in dem Parlament, das dem Herrscher zur Seite gestellt wurde, nur jene vertreten waren, die ebenfalls einiges zu verlieren hatten, wenn sie versuchten, ihre Befugnisse und ihren Einfluss über den verfassungsmässig vorgegebenen Rahmen auszuweiten. Das aber hiess, dass nur begüterte Eigentümer im Parlament vertreten sein konnten, am besten Landeigentümer, die durch die Immobilität ihres Vermögens sich dessen drohender Konfiskation nicht entziehen konnten, wie das bei Kapitaleigentümern der Fall war, die ihr Geld rechtzeitig ins Ausland verbringen konnten. Das freilich wurde zur Achillesferse der Koalition von Konstitutionalismus und Liberalismus: dass ein Grossteil der Bevölkerung von der politischen Partizipation ausgeschlossen blieb. Die Folge war eine dem Staat gegenüber gleichgültige bis feindselige Haltung der Bürger.
Nationalismus und Sozialismus
Es waren dann Nationalismus und Sozialismus, die dieses Regime paternalistischer Vernünftigkeit, hinter dem sich freilich immer auch eine gehörige Portion Eigeninteresse verbarg, politisch aufsprengten und einen sehr viel umfassenderen Freiheitsbegriff durchsetzten, einen, der nicht nur die Gesamtheit der Bevölkerung umfasste, sondern auch die Bürgerrechte über die Garantie des materiellen Eigentums hinaus erweiterte. Wer als Eigentum nur seine Arbeitskraft hatte, die er, um zu leben, zu Markte tragen musste, interessierte sich für die rechtliche Garantie des Eigentums als Kern der Freiheitsrechte wenig. Freiheit, so das Verständnis der Armen und wenig Begüterten, die sich seit der Französischen Revolution zunehmend Gehör verschafften, durfte sich nicht nur in der Garantie des Bestehenden erschöpfen, sondern zu ihr gehörte auch, dass jedem Bürger die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Freiheitsrechten verschafft wurde – und das hiess, die bürgerlichen Abwehrrechte gegenüber dem Staat um soziale Teilhaberechte zu ergänzen, bei denen der Staat in die Gesellschaft eingreifen musste, um sie sicherzustellen – etwa durch eine umfassende Besteuerung, und das nicht nur in linearer, sondern auch in progressiver Form.
«Die Bürger müssen aus freien Stücken dazu bereit sein, sich für den Betrieb einer freiheitlichen Ordnung in die Pflicht nehmen zu lassen.»
Die Durchsetzung der Demokratie gegen den blossen Konstitutionalismus, die in (West-)Europa mit der Französischen Revolution begann und nach dem Ersten Weltkrieg ihr Ziel erreicht hatte, brachte das Paradoxe in der Verknüpfung von Demokratie und Freiheit ans Tageslicht: dass es Freiheitsrechte gab, die beschnitten werden mussten, um den vielen die Inanspruchnahme der Freiheit überhaupt erst zu ermöglichen. Von nun an ging es darum, diese einander entgegengesetzten Imperative politisch auszutarieren. In funktionierenden Demokratien dreht sich Politik bis heute um diese Herausforderung. Systematisch ist die Demokratie mit dem Verfassungsgedanken eine Liaison eingegangen, durch die Vernünftigkeit gewährleistet werden soll. Die Verfassungsjuristen sind die Hüter dieser Vernünftigkeit.
Schwindende politische Partizipation
Darüber ist jedoch ein Problem aus dem Blick geraten, um das die Politiktheoretiker der Antike gewusst haben und dessen Vernachlässigung sich gegenwärtig schmerzlich spürbar macht: die Frage, wie viel politische Partizipation eine Demokratie braucht, um zuverlässig funktionieren zu können und den von Zeit zu Zeit neu auftretenden Herausforderungen gewachsen zu sein. Auch das lässt sich als Paradoxie formulieren: Die Bürger müssen aus freien Stücken dazu bereit sein, sich für den Betrieb einer freiheitlichen Ordnung in die Pflicht nehmen zu lassen. Diese Bereitschaft hat in den letzten Jahrzehnten, jedenfalls was Nachhaltigkeit und Langfristigkeit anbetrifft, kontinuierlich abgenommen, und das nach wie vor zu konstatierende bürgerschaftliche Engagement hat sich zunehmend projektförmig organisiert.
Konkret heisst das, dass die Bereitschaft zu längerfristigen Bindungen an eine politische Partei und deren Zielsetzungen schrumpft und durch das Engagement für moralisch hochstehende Vorhaben, von den globalen Menschenrechten bis zum Klima- oder Umweltschutz, verdrängt worden ist. Das ist ein Gebrauch von Freiheit, der ganz selbstverständlich zu einer freiheitlichen demokratischen Ordnung dazugehört. Aber womöglich, so die dritte Paradoxie, handelt es sich dabei um eine Inanspruchnahme von Freiheit, die, wenn sich tendenziell alle für sie entscheiden, freiheitsgefährdende Folgen hat. Ernst-Wolfgang Böckenförde hat das zu der Formel zugespitzt, der demokratische Rechtsstaat beruhe auf Voraussetzungen, die sicherzustellen er selbst nicht in der Lage sei. Er ist auf ein religiös oder ethisch begründetes Pflichtgefühl angewiesen, von dem er zehrt, ohne mit seinen Mitteln darauf einwirken zu können, dass diese Einstellung von Generation zu Generation erneuert wird.
Im Sinne der von Isaiah Berlin eingeführten Unterscheidung zwischen negativer und positiver Freiheit, Freiheit wovon und Freiheit wozu, würde das heissen, dass ohne die Bereitschaft vieler, die Lasten und Kosten positiver Freiheit freiwillig auf sich zu nehmen, auf Dauer niemand die Rechte der negativen Freiheit zuverlässig für sich in Anspruch nehmen kann. Liberale Freiheit bedarf eines republikanischen Freiheitsverständnisses, um gesichert zu sein. Das ist das Spannungsverhältnis, das ein westliches Demokratieverständnis permanent aushalten und für dessen Erneuerung es immer wieder andere Antworten finden muss. Offenbar befinden wir uns gegenwärtig wieder in einer Situation, in der neue Antworten auf diese Herausforderung vonnöten sind, wenn die demokratische Form der politischen Ordnung nicht zwischen neuen Oligarchien, altem Autoritarismus und einem kommunistisch verkleideten Patriarchalismus, wie er in China praktiziert wird, zerrieben werden soll.