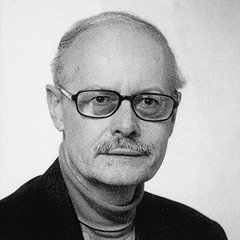Kein Ende der Geschichte
Gehen politische Partizipation und wirtschaftliche Innovation Hand in Hand?
Sind wir am Ende der Geschichte angekommen? Und was sind die dringendsten Reformen?
Gespräch mit einem, der es wissen muss.

Herr Acemoğlu, sind Sie mit den Institutionen der Confoederatio Helvetica vertraut?
Klar!
Dann wollen wir es vom Institutionenkenner hören – welches sind die grossen institutionellen Vorteile der Schweiz?
Das erreichte Gleichgewicht. Die Schweiz verfügt über viel soziale Sicherheit, sie investiert viel in Bildung, sie legt Wert auf ein unternehmerfreundliches Umfeld. Und alle Errungenschaften bedingen sich wechselseitig.
War’s das schon? Das ist es auch, was wir selbst zu wissen glauben.
Die Schweizer sind nicht smarter als Bürger anderer Länder. Aber sie haben einmalige politische Institutionen geschaffen. Die halbdirekte Demokratie begünstigt die Partizipation – und also das Engagement auf allen Ebenen. Die Leute wissen, dass von ihnen die Macht ausgeht. Und sie benutzen sie weise, nicht in erster Linie, um populistische Manöver zu unterstützen, sondern um die Macht des politischen Systems zu kontrollieren.
Der Schweizer Staat als begrenzter Staat – wirklich?
Ja, klar, jedenfalls in der Theorie. Einerseits funktioniert der Staat und liefert die Leistungen, die er liefern muss – der helvetische Staat ist kein Laisser-faire-Staat. Anderseits ist der Staat in seiner Macht auf die Bürger sehr beschränkt – durch ebendiese Bürger.
Die helvetische Publizistik rühmt sich weiterhin eines schlanken Staates – ein reiner Mythos!
Aber kein Problem. Denn was die meisten Bürger heutzutage erwarten, ist doch ein verantwortungsvoll und bedarfsgerecht agierender Staat – nicht einer also, der interveniert, weil sich ein paar Leute davon Privilegien versprechen, sondern einer, der im Dienste seiner Bürger das Zusammenleben erleichtert.
Lassen Sie uns über den Zusammenhang zwischen politischer Demokratie und ökonomischer Innovation sprechen. Führt das Erste zwangsläufig zum Zweiten? Oder kann Demokratie die Innovationsfähigkeit auch behindern?
Diese Frage wird in der Forschung gerade heiss debattiert! Die empirischen Daten sind aber ziemlich klar: Demokratie geht nicht einfach aus der allgemeinen Prosperität einer Volkswirtschaft hervor. Demokratie ist etwas, das geschaffen werden muss – und zugleich etwas, das in einem Prozess erlernt werden muss.
Sprechen Sie eher von direkter oder repräsentativer Demokratie?
Von beiden. Beide Systeme können gut funktionieren, beide können übel missbraucht werden. Nehmen Sie Kalifornien – der Bundesstaat hat die direkte Demokratie in den USA in Misskredit gebracht, weil der Staat totgespart wurde und die Infrastruktur verlotterte. Eine Demokratie wie das aktuelle Griechenland mit Parteien, die es bloss auf Rent-Seeking für ihre Günstlinge abgesehen haben, hat das System der repräsentativen Demokratie ad absurdum geführt.
Zurück zum Thema – sind funktionierende Demokratien also auf jeden Fall innovationsfreundlich?
Ich denke schon.
Und also wohlstandsfördernd?
Absolut.
China schafft Wohlstand auch ohne Demokratie.
China ist nicht besonders innovativ. Der Staat pumpt Unmengen von Geld in staatliche beziehungsweise staatsnahe Firmen – und fördert so wirtschaftliches Wachstum. Das Kapital ist allerdings schlecht alloziert, die Ineffizienzen sind beträchtlich, und China investiert bloss in bereits bestehende Technologien. Will das Land selbst zu einem Innovator werden, muss es die politischen Institutionen ändern und mehr Partizipation für die Bürger ermöglichen. Daran führt kein Weg vorbei.
Innovation lässt sich weder planen noch verordnen. Sie entsteht oftmals aus der Not – im Wettbewerb der Lösungen für sich abzeichnende Probleme.
Sie können nie wissen, woher sie kommt, die liebe Innovation. Sie können sie nicht zensieren – sie kann schmutzig sein oder disruptiv und Resultate zeitigen, die Ihnen nicht passen. Sie kann von einem Moment auf den anderen die Rente von Millionen von Menschen in einem schöpferischen Prozess zerstören. Wenn Sie in China bestehende Strukturen wirklich verändern, werden Sie erschossen – und deshalb wird das Land auf absehbare Zeit kein innovatives sein.
Warum ist aus Ihrer Sicht politische Freiheit unerlässlich, um Innovation hervorzubringen?
Wirtschaftliche und politische Freiheit gehören zusammen. Nehmen wir wiederum China: Es gibt da zwar pseudoprivate Firmen, die in Wahrheit aber mit der Politik verbandelt sind. Sie können nur in dem Rahmen agieren, den die Partei vorgibt. Das ist politischer Zwang – er ist der wirtschaftlichen Freiheit hinderlich. Und zweitens: Menschen, die sich nicht frei fühlen, haben Angst, etwas zu wagen. Die Mentalität sieht keine Experimente vor, sondern die Erfüllung bestehender, von irgendwelchen Behörden vorgegebener Abläufe im Rahmen des Systems.
Umgekehrt sind auch die Marktwirtschaften demokratischer europäischer Länder mittlerweile in unglaublichem Ausmasse staatlich dominiert.
Stimmt. Ich halte das für eine problematische Entwicklung.
Die Staatsquoten betragen unisono um die 50 Prozent.
Die Quote allein ist nicht massgebend. Es geht auch um die Befindlichkeit der Leute – fühlen sie sich eingeschränkt oder nicht? Fühlen sie sich ermutigt oder entmutigt?
Die Schweiz rangiert in allen möglichen Innovationsrankings stets auf den vorderen Plätzen. Was ist denn nun das Geheimnis des Erfolgs, den wir hier wohl selbst nicht wirklich verstehen? Meine These: es ist eine bestimmte Art der Not. Die Schweiz kann nicht anders, sie muss exportieren. Ihr Markt ist die Welt.
Guter Punkt. Viele kleine Länder sind in der Tat innovativ – aber längst nicht alle. Und die USA sind das perfekte Beispiel eines innovativen Landes, das gross und nicht offen ist.
Wenn nicht der Exportstress, was ist es dann?
Es ist ein Mix. In meinem Buch «Why Nations Fail» vertrete ich die These, dass die wichtigsten Voraussetzungen inklusive – im Gegensatz zu extraktiven, also ausbeutenden – politische Institutionen sind. Dies meint: Partizipation der Bürger, Kontrolle der politischen Macht, verantwortungsvolle Politiker, Rechtssicherheit, gesellschaftliche Stabilität. Ein weiterer Punkt kommt hinzu: die Akteure brauchen genügend Humankapital, um sich Aussicht darauf zu versprechen, im ökonomischen Spiel erfolgreich mitzumischen. Es geht um Bildung.
Selbstbildung? Volksbildung?
Allgemeine Bildung. Natürlich braucht es eine Elite – aber fundamental ist auch das hohe durchschnittliche Bildungsniveau der Leute. Dies erklärt auch, weshalb Schweden und Dänemark erstaunlich innovative Länder sind, trotz hohen Staatsquoten.
Im wesentlichen behaupten Sie also: Die guten alten demokratisch regierten Länder und jene wie Südkorea, die deren Schema ebenfalls anwenden, sind zugleich die innovativsten.
Das finden Sie keine besonders interessante These?
Die heutigen Demokratien sind letztlich Institutionen aus dem 18. Jahrhundert. Dies würde bedeuten, dass wir uns auf institutioneller Ebene kaum weiterentwickelt haben. Sind wir etwa am Ende der Geschichte angekommen?
Keineswegs! Die Theorien mögen alt sein, die Praxis ist jedoch stets work in progress. Grossbritannien nannte sich im 19. Jahrhundert eine Demokratie – aber nur die Hälfte der Bürger konnte wählen. Und so wie die Demokratie des 20. Jahrhunderts sich von jener des 19. Jahrhunderts unterschied, wird sich die Demokratie des 21. Jahrhunderts von jener des 20. Jahrhunderts unterscheiden. Es ist ja nicht so, dass die Leute zusammen- und einhellig übereinkommen: Nun machen wir mal ein bisschen Demokratie. Demokratie ist eine Konfliktverarbeitungsmaschinerie – möglichst so, dass die gesellschaftlichen Konflikte produktiv und friedlich ausgetragen werden. Darum ändern sich Demokratien ständig.
Welche Tendenzen zeichnen sich gegenwärtig in Demokratien ab?
Ich sehe vor allem deren zwei. Erstens: die Parteien an der Macht gleichen sich an, werden mithin ununterscheidbar – die Bürger haben keine echte Wahl mehr. Die Konsequenzen liegen auf der Hand: politische Apathie oder Protest. Zweitens: politische Macht und wirtschaftliche Interessenvertretung verbandeln sich immer mehr. Stichworte hier sind: Lobbyismus, Business kauft Politik, Politik schafft Rentner, Medien stützen Politiker, statt sie zu kritisieren.
Und wie können beziehungsweise sollten Demokratien darauf reagieren?
Die Entwicklung dürfte sich um ein Begriffspaar organisieren: Zentrum–Peripherie. Einerseits lebt die Demokratie von der Dezentralisierung – und die Schweiz ist mit der starken Gemeindeautonomie hier zukunftsweisend. Der Grund ist klar: Je dezentraler die Organisation, desto verantwortlicher ist sie, gerade mit Blick auf die öffentlichen Finanzen. Andererseits bedarf aber das Zentrum weiterhin einer genügend ausgeprägten politischen Macht, sonst wird die nationalstaatliche Politik – und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung – gelähmt. In der globalisierten Welt braucht es agile, gut organisierte, schnell reagierende Staaten. Wie das Zusammenspiel auszusehen hat, darauf gibt es keine vorfabrizierte Antwort. Trial and error!
Viele Bürgerproteste artikulieren sich längst nicht mehr an Wahlen, sondern in virtuellen Foren und Gruppen. Wie wird die voranschreitende Digitalisierung des Lebens das demokratische Zusammenleben verändern?
Sie führt zu mehr Engagement unter den Bürgern. Und zu mehr Transparenz unter den Politikern. Das ist gut für die Demokratie. Die Verstärkung der Partizipation könnte dazu führen, dass die direkte Demokratie Aufwind erhält – und dass das Wahlrecht auf neue Personengruppen ausgedehnt wird. Und die Transparenz dürfte zur Folge haben, dass sich Politiker genauer überlegen müssen, mit wem sie sich ins Bett legen.
Lassen Sie mich schwereres Geschütz auffahren. Statistiken belegen: um die 75 Prozent aller wiederkandidierenden Parlamentarier werden jeweils wiedergewählt. Wo genau ist also der Unterschied zwischen einer freiwilligen Demokratie und einer unfreiwilligen Oligarchie?
Gute Frage. Ich befürchte, es gibt darauf jenseits des Formaljuristischen ebenfalls keine eindeutige Antwort.
Dann könnte ja eine institutionelle Reform sein: Jeder Politiker wird bloss für eine Amtsdauer gewählt – und dann ist Schluss mit lustig.
Einverstanden – Begrenzung der Amtsdauer. Allerdings besteht dann die Gefahr, dass einfach ein anderes Mitglied der Gruppe oder Familie die Macht übernimmt. Die Strukturen wären mithin dieselben, nur wären sie weniger transparent. Was hier kluge Regeln der Amtszeitbeschränkung sein könnten, müsste man in Ruhe überlegen. Natürlich gibt es auch andere Zwangsmassnahmen, die für neues Blut in der Politik sorgen – Frauenquoten zum Beispiel.
Ein Graus!
Die Frauen haben dank Quoten das schwedische System ziemlich umgepflügt.
Wie wär’s mit einem Verfallsdatum für geltende Gesetze – einer Sunset-Klausel?
Es gibt Gesetze, deren Sinn in der Dauer liegt – denn nur diese schafft Rechtssicherheit und damit Berechenbarkeit und damit Verantwortlichkeit. Andere Gesetze bedürfen der ständigen Überprüfung, und ja, es stimmt: Die Zahl der Gesetze wächst in allen Demokratien. Ich würde meinen, eine solche Sunset-Klausel liesse sich auf Subventionsprogramme und Umverteilungsregimes anwenden. Eine gute Idee!
Gutes Stichwort: der Sozialstaat. Den europäischen Sozialstaaten geht langsam, aber sicher das Geld aus. Wie sehen hier Reformen mit Aussicht auf Erfolg aus?
Die Marktwirtschaft führt zu materieller Ungleichheit – und die grosse Frage ist: Wie lässt sich die Ungleichheit abfedern, um die Zustimmung zu einem grosso modo marktwirtschaftlichen System zu erhalten, ohne dass innovatives Handeln behindert wird?
Ja, wie?
Es gibt darauf wiederum keine einfache Antwort. Soziale Sicherheit kann unternehmerisches Handeln befördern, insofern sie den Risikonehmer vor dem Totalruin bewahrt – andererseits kann sie unternehmerisches Handeln behindern, weil sie Anreize schafft, in einer sicheren Umgebung auf Kosten anderer zu verharren. Es ist dies eine Frage der Balance.
Das klingt fast schon nach der Antwort eines Politikers, der niemanden erzürnen will.
Es ist eine ehrliche Antwort. Das grosse Problem in Europa, aber auch in den USA ist das folgende: Es gibt viel Umverteilung in der Mitte der Gesellschaft. Und das Geld kommt nicht da an, wo es ankommen sollte – ganz unten.
Damit wären wir wiederum bei einem fundamentalen Problem der sozialstaatlich organisierten Demokratien angelangt: Hier wird mit dem Versprechen von Benefits auf Verführungsbasis regiert.
Stimmt. Dagegen hilft nur eins: Aufklärung. Transparenz. Bildung. Wenn Leute der Mittelschicht Geld erhalten, dann sind sie es ja auch, die das Geld zuvor per Steuern abgeliefert haben. Aber umgekehrt sollten jene, die in Not geraten sind, auf die Hilfe des Staates zählen können. Sonst funktioniert eine moderne Demokratie nicht. Sonst haben Sie keinen gesellschaftlichen Frieden.
Mit welchen Reformen liesse sich die soziale Mobilität verstärken?
Die Anreize sind da – nur fehlen zuweilen die Gelegenheiten.
Der Staat kann sie nicht schaffen, das kann nur die Privatwirtschaft – wenn man sie machen lässt.
Das stimmt im Prinzip, aber nicht immer im Detail. Nehmen wir die USA: Die soziale Mobilität ist trotz einer extrem dynamischen Wirtschaft geringer als in Europa. Warum? Ganz einfach: in Massachusetts oder Kalifornien ist die Mobilität hoch, im Süden der USA dagegen minim. In den ersten beiden Staaten ist das Niveau von Schulen und Integrationskursen gut, im Süden hingegen nicht. Insofern hat der Staat durchaus eine wichtige Aufgabe – nicht indem er die Wirtschaft reguliert, sondern indem er dafür sorgt, dass die Leute etwas lernen.
Sie sagen wiederum, was hier die meisten Politiker sagen. Wie gefällt Ihnen eigentlich die Schweiz?
Phantastisch! Ich mag die Leute. Sie sind auch ziemlich ausbalanciert – wie die Institutionen. Aber aufgepasst. Die Welt dreht schnell. Ein Land, das heute top ist, kann schon in zehn Jahren nur mehr Durchschnitt sein.
Wir danken der St. Gallen Foundation für die Vermittlung des Kontakts und für die Organisation des Gesprächs.